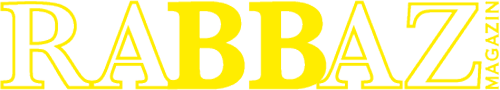Die Zukunft gehört der Jugend, möchte man meinen, wenn man mit logischem Menschenverstand durch die Welt geht. In unserer Wohlstands- und Wirtschaftsnation Deutschland bekommt man dennoch immer wieder das Gefühl, dass die Politik in Sachen Jugend, Zukunft und Generationsgerechtigkeit schlichtweg: versagt
Continue readingDas mache ich nächstes Jahr definitiv wieder!
„Ich hol mir ein Bier und dann geh ich zur Main Stage!“, schreie ich meiner besten Freundin in ihr linkes Ohr. Ihr Blick ist leer. Das ist das Zeichen, dass ich befürchtet hatte. Sie hat kein Wort verstanden. Wortlos nehme ich mir ihr Handy und schreibe das eben Gesagte nochmal in ihre Notizen-App. Ein Nicken symbolisiert mir, dass ich losgehen kann.
Der Boden ist voller Konfetti und zertretener Plastikbecher. Der Bass drückt im Zwerchfell und die Lichter tanzen vor meinen Augen. Es fällt mir schwer bei den tausenden von Leuten um mich herum den Überblick zu behalten. Also kämpfe ich mich durch knutschende Pärchen, springende Teenager und feiernde Massen bis zum Getränkestand meines Vertrauens durch und versuche mein Glück.
„Ein Bier bitte!“ Und wieder sind es die leeren Augen, die mir verdeutlichen: Der Barmann hat nicht ein Wort von dem, was ich gesagt habe, verstanden. Also selbes Spiel von vorne. Ich hole diesmal mein Handy raus und tippe die gesagten Worte. Er nickt und während ich auf meine Bestellung warte, drehe ich mich in Richtung Bühne. Eine Mischung aus Serotoninüberschuss und Alkohol macht mein Hirn so wuschig, dass ich mir wünsche, das Festival würde niemals enden und das, obwohl ich hier niemanden kenne.
Es ist Samstag und damit Tag zwei der dreitägigen Dauerparty. Das heißt, die Dixies sind nicht mehr benutzbar, die Hälfte meiner Freunde wird sich heute Nacht noch auf dem Campingplatz verlaufen und ich habe trotz morgendlicher Dusche so viel Staub und Sand am ganzen Körper, dass ich mir aus heutiger Sicht wünschen würde, auch damals schon einen Mundschutz gehabt zu haben. Vielleicht würde der latente Urin-Bier-Schweiß-Geruch dann auch nicht so in der Nase brennen.
Ich bezahle mein viel zu überteuertes Bier, mache mich auf in Richtung Mainstage und bin glücklich. Das erste Mal seit langem fühle ich mich genau dort richtig, wo ich gerade bin.
Bin ich doch sonst ein eher zerstreuter Typ Mensch, der mit den Gedanken immer woanders ist, fügen sich hier alle Puzzleteile zusammen, die ein für mich stimmiges Bild ergeben. Keine Gedanken daran, wo man gerade lieber wäre, was man noch zu tun hat – nein – nicht einmal Sorgen um die verlorenen Freunde mache ich mir, während ich alleine über das Festivalgelände wandere. Ich habe die sogenannte Zeit meines Lebens. „Das mache ich nächstes Jahr definitiv wieder!“, verspreche ich mir.
Oh, wie naiv ich doch war. Konnte ja keiner ahnen, dass ein knappes Jahr später Corona die Welt in Atem halten würde. In der Praxis heißt das für uns alle, dass es seit April keine Großveranstaltungen mehr gibt. Keine Partys, keine Festivals, kein Oktoberfest, nichts. Entschuldigt meine Wortwahl, aber mich fuckt es übertrieben ab. Hatte ich für 2020 doch so viel geplant. Von Rock am Ring bis Fusion war meine Bucketlist voll mit Festivals und Exzessen. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem ich meine erste Quarterlife-Crisis mit einem unvergesslichen Sommer verdrängen wollte. Ja, ich wollte einen unvergesslichen Sommer, aber nicht so!
Statt jetzt brutzelnd auf dem Campingplatz zu liegen und mir eine Mischung aus Glitzer, Blumen und Sand ins Gesicht zu klatschen, liege ich in meinem Bett und denke darüber nach, was hätte sein können. Klar, statt unbequemer Isomatte und Schlafsack tue ich meinem Rücken eine Wohltat, wenn ich weiterhin auf meiner dreifach-isolierten Memoryschaummatratze schlafe, doch dieses Jahr zieht sich. Vergingen Corona-Winter und -Frühling doch super schnell, läuft der (Festival-)Sommer wie in Zeitlupe an mir vorbei und streckt mir im Vorbeigehen seinen Mittelfinger ins Gesicht. Zu wissen, dass ich auf Bier-Pong, Flunky-Ball und dreitägiges Wabern zwischen Tag und Nacht noch mindestens ein Jahr warten muss, lässt mich sogar die anstrengenden Besoffskis vermissen, die sich einem unvorhergesehen um den Hals werfen.
Doch nur, weil es Grenzen und Auflagen gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass sich auch alle daran halten. Während auf der einen Seite heftig daran gefeilt wird, die Clubkultur mit Hygienekonzepten zu retten, tritt man auf der anderen Seite den wochenlang erarbeiteten Infizierten-Vorsprung mit Füßen. Illegale Partys in Wäldern und Straßen des Bundesgebietes sind die neuen Castor-Demonstranten. Und das Schlimme ist, ich habe sogar Verständnis dafür. Ich bin auch jung und habe keine Lust mehr, zu Hause zu bleiben und die Füße im wahrsten Sinne des Wortes stillzuhalten. Trotzdem will ich nicht dazu beitragen, dass der Festivalsommer 2021 auch noch in Gefahr gerät. Meine Laune schwankt zwischen Verständnis und Rebellion, doch ich habe beschlossen, mich für ein doppelt und dreifach exzessives 2021 zusammenzureißen. Also bewege ich mich im Rahmen des Möglichen und besuche die lokalen Bars und Parks mit meinen Freunden, ohne Teil eines Superspreader-Raves zu werden. Im Prinzip wollen wir ja alle nur, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Das geht halt leider nur nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also appelliere ich wie jedes Wochenende an meine Vernunft und sage mir: „Das mache ich nächstes Jahr definitiv wieder!“
Text und Bild: Janna Meyer
Die in dieser Kolumne dargestellten Sichtweisen sind allein der Autorin zuzuordnen und spiegeln nicht die Meinung der gesamten Redaktion wider.
Zoom me up, Scotty
Die letzten Wochen des ersten reinen Online-Semesters brechen an. Und ich muss sagen: zum
Glück. 2020 schafft mich. Hatte ich doch nie ein Problem mit FOMO, der sogenannten „Fear Of
Missing Out“, bin ich 2020, dem einzigen Jahr, in dem die Welt still steht, vollkommen gestresst.
Ständig wandert mein Blick auf die sozialen Medien, in denen Jungs und Mädels teilen, wo sie
heute vor einem Jahr waren. Vor einem Jahr war mein Leben genauso wie es aktuell ist und
gestört hat es mich nicht. Nun muss ich mich für eine gewisse Zeit einschränken und siehe da, ich
drehe ab. Perfektes Timing. Da kam mir das Online-Semester sehr gelegen. Die romantische
Vorstellung die Quarantäne mit dem Schreiben von Hausarbeiten und Exposés zu verbringen, in
der Hoffnung, es würde mir schneller über die Zeit der Corona-Maßnahmen hinweghelfen, ist
rückblickend auch etwas naiv gewesen. Denn nun sitze ich hier und habe so viele Deadlines, dass
ich mich vor Abgabestress kaum noch retten kann. Und die Zeit vergeht auch nicht schneller.
Mich dünkt, ich habe einen schlechten Deal gemacht.
Der Tatsache geschuldet, dass ich die letzten Semester nicht viel in der Uni war, wollte ich dem
Ganzen ein Ende setzen und das digitale Semester nutzen, um die noch fehlenden Kurse vor dem
Bachelor aufzuholen. Was für ein Fehler. Denn das, was man sich an Fahrtzeiten zur Uni spart,
hole ich mir nun elegant durch doppelten Arbeitsaufwand für die aktive Teilnahme wieder rein.
Eine Präsentation hier, ein kurzer Essay dort und überall ständig diese kleinen schriftlichen
Antworten, die man zu jedem Text einreichen soll. Dafür, dass ich am Anfang noch so ambitioniert
war und stets jede freie Minute genutzt habe, um mich auf die Online-Kurse vorzubereiten, hat
mich meine Motivation doch recht schnell verlassen. Spätestens, als ich entdeckt habe, dass man
ja nicht mal wirklich aktiv anwesend sein muss, um an solchen Online-Kursen teilzunehmen,
schlich sich mein altbekanntes Prokrastinations-Muster wieder ein. Ein ausgeschaltetes Mikro in
Kombination mit einer deaktivierten Kamera stehen symbolisch für meine letzten drei Jahre an der
Uni. Wie war das noch? Ein gutes Pony springt nur so hoch, wie es muss? Nun, in diesem Fall bin
ich ein olympisches Pony.
Ich habe mir nie viel aus der Uni gemacht. War immer ein kleiner Hänger, der seine Zeit lieber fürs
Schreiben oder Schwärmen von einer Zeit nach dem Studium genutzt hat. Was passiert also,
wenn diese Einstellung auf ein Online-Semester trifft, dass zu 80 % auf ein Selbststudium
ausgelegt ist? Sagen wir so, Stand jetzt habe ich noch 90 Texte zu lesen, die ich theoretisch
schon die letzten Wochen hätte gelesen haben sollen und eventuell relevant wären, um mich gut
auf meine bevorstehenden Hausarbeiten vorzubereiten. Aber das soll nicht mein Problem sein.
Darum wird sich Zukunfts-Janna kümmern, wenn sie mit Tränen in den Augen vor den Scherben
des Semesters steht.
So sehr ich es auch feiere, dass ich mir die 50 Minuten Ring- und U-Bahn zur Uni sparen kann, so
sehr freue ich mich auch darüber, dass ich nächstes Semester nur noch den Endgegner
Bachelorarbeit bezwingen muss. Sollte die Zeit an der Uni doch die schönste Zeit des Lebens
sein, war sie für mich bisher im Prinzip auch nicht viel anders als die Zeit am örtlichen
Gymnasium. Der einzige Unterschied liegt darin, dass man halt mehr als dieselben 30 Pappnasen
sieht, denen man sich zu Schulzeiten aussetzen musste. Doch ich will nicht undankbar dem
Semester gegenüberstehen. Hat es mir doch geholfen, dass ich jetzt drei verschiedene Video-
Call-Programme auf meinem Rechner installiert habe und nun Experte darin bin, wie man per
Greenscreen-Funktion einen 5-Sekunden-Lacher generieren kann. Also Leute, in diesem Sinne:
Wir haben es bald geschafft und es kommen auch wieder Zeiten, in denen wir uns das Essen in
der Mensa schmecken lassen können. Bis dahin findet ihr mich online. Also: Zoom me up, Scotty!
Text und Bild: Janna Meyer
Harte Zeiten für unsere Clubkultur
Wie die ausbleibenden Bässe unsere Szene bedrohen
Dass sich die Chemnitzer Szene schon vor dem Ausbruch des Coronavirus schwergetan hat, ist kein Geheimnis. Der Wunsch nach Spätis und einem musikalischen Veranstaltungsangebot, das nicht vorwiegend nur aus Indiepop-Bandauftritten besteht ist älter als so manch immatrikulierte*r Student*in. Der alte Hut, die ewige Chemnitzer Leier, es nervt. Ob nun das fehlende Angebot oder mangelnde Nachfrage schuld seien oder ob man es uns einfach nicht recht machen kann, darüber lässt sich streiten. Vielleicht ändert das übernächste Paula Irmschler Buch oder die nächste Kummer Kassette mit Trettmann Feature etwas, die Hoffnung soll man ja nie aufgeben.
Das Kommen und Gehen in der Chemnitzer Clublandschaft kennt auch das Künstler*innen-Kollektiv Reset, mit denen ich über die aktuelle Situation gesprochen habe. Wie viele sehen sie einen Grund für das Schließen vieler Clubs in der geringen Anzahl junger Menschen in Chemnitz. Doch sie sehen auch wie eine Szene immer facettenreicher wird und stetig wächst.
Viele Clubs, so das Kollektiv, finanzieren sich von Party zu Party und stecken viel Liebe und Eigeninitiative in ihre Projekte. Rücklagen oder Gewinne haben dabei keine Priorität. Die Auswirkungen des Coronavirus treffen die Szene daher besonders. „Es wäre einfach zu traurig, wenn Chemnitz durch dieses Tief wieder bei null anfangen müsste und verlieren würde, was sich so viele Leute in Kleinprojekten und im Kollektiv hart erarbeitet haben.“ Die Drohende Gefahr spüren alle Mitglieder des Kollektivs: Von festen und angehenden DJ‘s über Veranstaltungstechniker*innen bis hin zu Gestaltungs- und Dekorationskünstler*innen, denn viele beziehen ihr Einkommen hauptsächlich aus dieser Branche und sind von Kooperationen mit Clubs, sowie der Festival- und Open-Air-Saison abhängig. Für das Reset-Kollektiv zählt nun vor allem Solidarität und Zusammenhalt: „Chemnitz reagiert, es wird improvisiert und es wird im Kollektiv gehandelt.“ Der Schlüssel liegt dabei für die Künstler*innen in der Kommunikation, denn ohne diese gäbe es keine Kooperation und somit auch keine Gemeinschaft. Man ergreift alle Möglichkeiten, um der Kunst in dieser Zeit Raum zu geben und verlegt die Partys eben kurzerhand per Livestreams ins Wohnzimmer, wie bei Atomino TV oder Oberdeck meets Reset. Solidarität heißt für das Reset-Kollektiv aber auch Auflegen ohne Gage, wenn den Clubbetreiber*innen das zahlende Publikum fehlt. Man hält eben zusammen.
Auch das Transit kämpft gegen die Auswirkungen der Krise. Am Wochenende des Shutdowns wäre der 2. Geburtstag des Clubs mit 30 Künstler*innen gefeiert worden. Das transit-Team sieht die Krise jedoch auch von Seiten der Clubbesucher*innen: „Kulturell bieten Clubs einen Ort der Sozialisierung, hier werden Barrieren abgebaut und Freundschaften über Gemeinsamkeiten geknüpft. Durch das Kontaktverbot leiden also vor allem unsere Gäste.“ Damit freischaffende Künstler*innen die Krise überstehen können, wünscht man sich auch hier wirkungsvolle Unterstützung von Seiten der Politik. „Sachsen ist das einzige Bundesland, in dem es aktuell nur Kredite und keine Zuschüsse für solo-selbständig arbeitende Personen gibt. Wir hoffen, dass sich gerade hier zeitnah etwas tut. Es verlieren schon jetzt Künstler*Innen ihre Lebensgrundlage.“, erklärt Christian vom Transit. (Anm. d. Red.: Der sächsische Landtag hat mittlerweile Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro bewilligt*) Um die Existenz des Clubs in den kommenden Monaten zu sichern wird man kreativ und setzt wie viele andere Chemnitzer Clubs auch auf die Unterstützung der Feiernden. Selbstgemachte Spendengegenleistungen wie Tabakbeutel, sowie ein Soli-Ticket, das die gesamte Chemnitzer Szene unterstützt sind Möglichkeiten unsere Szene am Leben zu halten.
Bereits vor der Corona Zeit sah man in den letzten Jahren einen Trend in der Kultur- und Feierszene, der vielen Nachtschwärmer*innen Sorgen bereitete. Clubs, Bars und andere Sammelbecken für Kreative und Kulturschaffende werden von ihrem rechtmäßigen Platz im Stadtbild verdrängt oder müssen schließen. Der Grund für die Schließung solcher Freiräume liegt manchmal in steigenden Mieten und profitorientierten Investoren, wie im Falle der Grießmühle in Berlin, manchmal aber auch einfach in Problemen mit Genehmigungen und Anwohner*innen wie bei der Coffee-Art-Bar hier in Chemnitz. Die Forderungen der Clubbetreiber*innen und Kulturschaffenden sind meist ähnlich: Die Politik muss agieren und aktiv zum Erhalt der Szene beitragen. Selbes gilt besonders jetzt in Zeiten einer Krise, denn der Erhalt dieser Freiräume, die selbstverständlich nicht immer in unsere gewinnorientierte kapitalistische Welt passen, ist mindestens so wichtig wie milliardenschwere Finanzspritzen für große Unternehmen. Wir brauchen die Szene, ganz besonders hier in Chemnitz, denn sie gehört genauso zum Kulturgut wie Museen und Theater. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Einsicht nicht zu spät kommt.
Hier könnt ihr die Chemnitzer Clublandschaft mit einem Soli-Ticket unterstützen:
*Quelle: https://www.mdr.de/sachsen/dresden/dresden-radebeul/corona-sonderprogramm-kuenstler-sachsen-100.html Stand 22.04.2020
Text: Jan Hilbert
Bild: pasevichbogdan | Pixabay