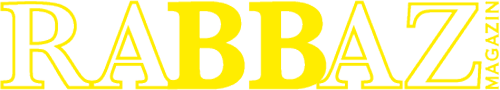When you are thinking about sexual harassment, how does the typical victim look in your mind? A young woman, attractive, long hair and a lot of skin showing? This would be the stereotype that the majority of people have in mind.
Continue readingSpät…später…Späti!
Manchmal hat man was vergessen. Manchmal ist es spontan. Manchmal hat man einfach Bock. Meistens ist es zu spät. Wenn die Läden zu haben und man doch noch was braucht, ist ein Spätverkauf der Retter in der Not. Bei Heißhunger in der Nacht, einer Zahnbürste für spontanen Besuch und trockener Kehle auf dem Heimweg. In den meisten Großstädten kein Problem, aber in Chemnitz? Das Sächsische Ladenöffnungsgesetz* macht uns einen Strich durch die Rechnung und nachdem der Döner-Drive-In als traditionelle letzte Einkehr einer Baustelle weichen musste, sieht es nun besonders finster aus.
Das haben auch Anna und Karin festgestellt. Beide studieren seit einem Jahr IKK im Master an der TU Chemnitz und wollten das nicht so stehen lassen. Durch Rumfragen und einen glücklichen Zufall sind sie an die Räumlichkeit an der Jakobstraße 42/Ecke Zietenstraße geraten. Einige kennen den Laden bereits als „Späti“. Dieser entstand vor etwa zwei Jahren im Rahmen der Dialogfelder als ortsspezifische Installation unter dem Namen „Kiosk“. Johannes Specks und Marie Donike wollten den Chemnitzerinnen und Chemnitzern für eine Woche einen Ort schenken, an dem Menschen sich begegnen und ins Gespräch kommen – zwischen Bockwurst, Bier und Süßwaren.
Diese Vision greifen Anna und Karin auf. Angeschlossen an den Klub Solitaer e.V. wollen sie ihrem Geschäft einen gemeinnützigen Rahmen geben, denn ein Späti ist mehr als nur ein Ort für sofortigen Bedarf. Er soll auf niederschwellige Weise zum Verweilen und Vermischen verschiedenster Menschen einladen. Außerdem soll die Räumlichkeit auch für Veranstaltungen genutzt werden können. Weiterhin soll das Sortiment partizipativ gestaltet werden: auf Tapeten und über Einwurfboxen können Wünsche geäußert werden, was im Späti verkauft werden soll. So kann jeder in in die Entwicklung des Ladens einbezogen werden.
Zum Glück soll Annas und Karins Laden (der übrigens richtig der „Späti“ heißt) dauerhaft geöffnet sein. Vorerst Sonntag und Montag, damit auch an diesen Tagen etwas auf dem Sonnenberg los ist, in Zukunft auch an weiteren Tagen, wenn sich noch weitere Späti-Begeisterte finden, die das Geschäft unterstützen wollen. Die wichtigste Frage aber: Auch in der Nacht? Bis Mitternacht ist immer jemand vor Ort, danach sind die beiden über das Spätiphon (015735428699) erreichbar und können Auskunft geben, ob danach noch verkauft wird. Mit dem sogenannten „Dampfnudel-Trick“, wie Karin ihn genannt hat, kann man das Sächsische Ladenöffnungsgesetz geschickt umgehen, denn es gibt immer ein Gericht – damit ist der „Späti“ auch ein Imbiss und darf länger verkaufen.
*(Öffnungszeiten für Läden gelten von Montag bis Freitag 6 bis 22 Uhr)
Text: Linda Kolodjuk
Bild: Rose Kuhn
Das mache ich nächstes Jahr definitiv wieder!
„Ich hol mir ein Bier und dann geh ich zur Main Stage!“, schreie ich meiner besten Freundin in ihr linkes Ohr. Ihr Blick ist leer. Das ist das Zeichen, dass ich befürchtet hatte. Sie hat kein Wort verstanden. Wortlos nehme ich mir ihr Handy und schreibe das eben Gesagte nochmal in ihre Notizen-App. Ein Nicken symbolisiert mir, dass ich losgehen kann.
Der Boden ist voller Konfetti und zertretener Plastikbecher. Der Bass drückt im Zwerchfell und die Lichter tanzen vor meinen Augen. Es fällt mir schwer bei den tausenden von Leuten um mich herum den Überblick zu behalten. Also kämpfe ich mich durch knutschende Pärchen, springende Teenager und feiernde Massen bis zum Getränkestand meines Vertrauens durch und versuche mein Glück.
„Ein Bier bitte!“ Und wieder sind es die leeren Augen, die mir verdeutlichen: Der Barmann hat nicht ein Wort von dem, was ich gesagt habe, verstanden. Also selbes Spiel von vorne. Ich hole diesmal mein Handy raus und tippe die gesagten Worte. Er nickt und während ich auf meine Bestellung warte, drehe ich mich in Richtung Bühne. Eine Mischung aus Serotoninüberschuss und Alkohol macht mein Hirn so wuschig, dass ich mir wünsche, das Festival würde niemals enden und das, obwohl ich hier niemanden kenne.
Es ist Samstag und damit Tag zwei der dreitägigen Dauerparty. Das heißt, die Dixies sind nicht mehr benutzbar, die Hälfte meiner Freunde wird sich heute Nacht noch auf dem Campingplatz verlaufen und ich habe trotz morgendlicher Dusche so viel Staub und Sand am ganzen Körper, dass ich mir aus heutiger Sicht wünschen würde, auch damals schon einen Mundschutz gehabt zu haben. Vielleicht würde der latente Urin-Bier-Schweiß-Geruch dann auch nicht so in der Nase brennen.
Ich bezahle mein viel zu überteuertes Bier, mache mich auf in Richtung Mainstage und bin glücklich. Das erste Mal seit langem fühle ich mich genau dort richtig, wo ich gerade bin.
Bin ich doch sonst ein eher zerstreuter Typ Mensch, der mit den Gedanken immer woanders ist, fügen sich hier alle Puzzleteile zusammen, die ein für mich stimmiges Bild ergeben. Keine Gedanken daran, wo man gerade lieber wäre, was man noch zu tun hat – nein – nicht einmal Sorgen um die verlorenen Freunde mache ich mir, während ich alleine über das Festivalgelände wandere. Ich habe die sogenannte Zeit meines Lebens. „Das mache ich nächstes Jahr definitiv wieder!“, verspreche ich mir.
Oh, wie naiv ich doch war. Konnte ja keiner ahnen, dass ein knappes Jahr später Corona die Welt in Atem halten würde. In der Praxis heißt das für uns alle, dass es seit April keine Großveranstaltungen mehr gibt. Keine Partys, keine Festivals, kein Oktoberfest, nichts. Entschuldigt meine Wortwahl, aber mich fuckt es übertrieben ab. Hatte ich für 2020 doch so viel geplant. Von Rock am Ring bis Fusion war meine Bucketlist voll mit Festivals und Exzessen. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem ich meine erste Quarterlife-Crisis mit einem unvergesslichen Sommer verdrängen wollte. Ja, ich wollte einen unvergesslichen Sommer, aber nicht so!
Statt jetzt brutzelnd auf dem Campingplatz zu liegen und mir eine Mischung aus Glitzer, Blumen und Sand ins Gesicht zu klatschen, liege ich in meinem Bett und denke darüber nach, was hätte sein können. Klar, statt unbequemer Isomatte und Schlafsack tue ich meinem Rücken eine Wohltat, wenn ich weiterhin auf meiner dreifach-isolierten Memoryschaummatratze schlafe, doch dieses Jahr zieht sich. Vergingen Corona-Winter und -Frühling doch super schnell, läuft der (Festival-)Sommer wie in Zeitlupe an mir vorbei und streckt mir im Vorbeigehen seinen Mittelfinger ins Gesicht. Zu wissen, dass ich auf Bier-Pong, Flunky-Ball und dreitägiges Wabern zwischen Tag und Nacht noch mindestens ein Jahr warten muss, lässt mich sogar die anstrengenden Besoffskis vermissen, die sich einem unvorhergesehen um den Hals werfen.
Doch nur, weil es Grenzen und Auflagen gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass sich auch alle daran halten. Während auf der einen Seite heftig daran gefeilt wird, die Clubkultur mit Hygienekonzepten zu retten, tritt man auf der anderen Seite den wochenlang erarbeiteten Infizierten-Vorsprung mit Füßen. Illegale Partys in Wäldern und Straßen des Bundesgebietes sind die neuen Castor-Demonstranten. Und das Schlimme ist, ich habe sogar Verständnis dafür. Ich bin auch jung und habe keine Lust mehr, zu Hause zu bleiben und die Füße im wahrsten Sinne des Wortes stillzuhalten. Trotzdem will ich nicht dazu beitragen, dass der Festivalsommer 2021 auch noch in Gefahr gerät. Meine Laune schwankt zwischen Verständnis und Rebellion, doch ich habe beschlossen, mich für ein doppelt und dreifach exzessives 2021 zusammenzureißen. Also bewege ich mich im Rahmen des Möglichen und besuche die lokalen Bars und Parks mit meinen Freunden, ohne Teil eines Superspreader-Raves zu werden. Im Prinzip wollen wir ja alle nur, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Das geht halt leider nur nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also appelliere ich wie jedes Wochenende an meine Vernunft und sage mir: „Das mache ich nächstes Jahr definitiv wieder!“
Text und Bild: Janna Meyer
Die in dieser Kolumne dargestellten Sichtweisen sind allein der Autorin zuzuordnen und spiegeln nicht die Meinung der gesamten Redaktion wider.
Harte Zeiten für unsere Clubkultur
Wie die ausbleibenden Bässe unsere Szene bedrohen
Dass sich die Chemnitzer Szene schon vor dem Ausbruch des Coronavirus schwergetan hat, ist kein Geheimnis. Der Wunsch nach Spätis und einem musikalischen Veranstaltungsangebot, das nicht vorwiegend nur aus Indiepop-Bandauftritten besteht ist älter als so manch immatrikulierte*r Student*in. Der alte Hut, die ewige Chemnitzer Leier, es nervt. Ob nun das fehlende Angebot oder mangelnde Nachfrage schuld seien oder ob man es uns einfach nicht recht machen kann, darüber lässt sich streiten. Vielleicht ändert das übernächste Paula Irmschler Buch oder die nächste Kummer Kassette mit Trettmann Feature etwas, die Hoffnung soll man ja nie aufgeben.
Das Kommen und Gehen in der Chemnitzer Clublandschaft kennt auch das Künstler*innen-Kollektiv Reset, mit denen ich über die aktuelle Situation gesprochen habe. Wie viele sehen sie einen Grund für das Schließen vieler Clubs in der geringen Anzahl junger Menschen in Chemnitz. Doch sie sehen auch wie eine Szene immer facettenreicher wird und stetig wächst.
Viele Clubs, so das Kollektiv, finanzieren sich von Party zu Party und stecken viel Liebe und Eigeninitiative in ihre Projekte. Rücklagen oder Gewinne haben dabei keine Priorität. Die Auswirkungen des Coronavirus treffen die Szene daher besonders. „Es wäre einfach zu traurig, wenn Chemnitz durch dieses Tief wieder bei null anfangen müsste und verlieren würde, was sich so viele Leute in Kleinprojekten und im Kollektiv hart erarbeitet haben.“ Die Drohende Gefahr spüren alle Mitglieder des Kollektivs: Von festen und angehenden DJ‘s über Veranstaltungstechniker*innen bis hin zu Gestaltungs- und Dekorationskünstler*innen, denn viele beziehen ihr Einkommen hauptsächlich aus dieser Branche und sind von Kooperationen mit Clubs, sowie der Festival- und Open-Air-Saison abhängig. Für das Reset-Kollektiv zählt nun vor allem Solidarität und Zusammenhalt: „Chemnitz reagiert, es wird improvisiert und es wird im Kollektiv gehandelt.“ Der Schlüssel liegt dabei für die Künstler*innen in der Kommunikation, denn ohne diese gäbe es keine Kooperation und somit auch keine Gemeinschaft. Man ergreift alle Möglichkeiten, um der Kunst in dieser Zeit Raum zu geben und verlegt die Partys eben kurzerhand per Livestreams ins Wohnzimmer, wie bei Atomino TV oder Oberdeck meets Reset. Solidarität heißt für das Reset-Kollektiv aber auch Auflegen ohne Gage, wenn den Clubbetreiber*innen das zahlende Publikum fehlt. Man hält eben zusammen.
Auch das Transit kämpft gegen die Auswirkungen der Krise. Am Wochenende des Shutdowns wäre der 2. Geburtstag des Clubs mit 30 Künstler*innen gefeiert worden. Das transit-Team sieht die Krise jedoch auch von Seiten der Clubbesucher*innen: „Kulturell bieten Clubs einen Ort der Sozialisierung, hier werden Barrieren abgebaut und Freundschaften über Gemeinsamkeiten geknüpft. Durch das Kontaktverbot leiden also vor allem unsere Gäste.“ Damit freischaffende Künstler*innen die Krise überstehen können, wünscht man sich auch hier wirkungsvolle Unterstützung von Seiten der Politik. „Sachsen ist das einzige Bundesland, in dem es aktuell nur Kredite und keine Zuschüsse für solo-selbständig arbeitende Personen gibt. Wir hoffen, dass sich gerade hier zeitnah etwas tut. Es verlieren schon jetzt Künstler*Innen ihre Lebensgrundlage.“, erklärt Christian vom Transit. (Anm. d. Red.: Der sächsische Landtag hat mittlerweile Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro bewilligt*) Um die Existenz des Clubs in den kommenden Monaten zu sichern wird man kreativ und setzt wie viele andere Chemnitzer Clubs auch auf die Unterstützung der Feiernden. Selbstgemachte Spendengegenleistungen wie Tabakbeutel, sowie ein Soli-Ticket, das die gesamte Chemnitzer Szene unterstützt sind Möglichkeiten unsere Szene am Leben zu halten.
Bereits vor der Corona Zeit sah man in den letzten Jahren einen Trend in der Kultur- und Feierszene, der vielen Nachtschwärmer*innen Sorgen bereitete. Clubs, Bars und andere Sammelbecken für Kreative und Kulturschaffende werden von ihrem rechtmäßigen Platz im Stadtbild verdrängt oder müssen schließen. Der Grund für die Schließung solcher Freiräume liegt manchmal in steigenden Mieten und profitorientierten Investoren, wie im Falle der Grießmühle in Berlin, manchmal aber auch einfach in Problemen mit Genehmigungen und Anwohner*innen wie bei der Coffee-Art-Bar hier in Chemnitz. Die Forderungen der Clubbetreiber*innen und Kulturschaffenden sind meist ähnlich: Die Politik muss agieren und aktiv zum Erhalt der Szene beitragen. Selbes gilt besonders jetzt in Zeiten einer Krise, denn der Erhalt dieser Freiräume, die selbstverständlich nicht immer in unsere gewinnorientierte kapitalistische Welt passen, ist mindestens so wichtig wie milliardenschwere Finanzspritzen für große Unternehmen. Wir brauchen die Szene, ganz besonders hier in Chemnitz, denn sie gehört genauso zum Kulturgut wie Museen und Theater. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Einsicht nicht zu spät kommt.
Hier könnt ihr die Chemnitzer Clublandschaft mit einem Soli-Ticket unterstützen:
*Quelle: https://www.mdr.de/sachsen/dresden/dresden-radebeul/corona-sonderprogramm-kuenstler-sachsen-100.html Stand 22.04.2020
Text: Jan Hilbert
Bild: pasevichbogdan | Pixabay
Mit „Superbusen“ durch den Bazillentunnel und über Chemnitz hinaus
Paula Imschler beschreibt Emotionen, die alle Chemnitzer*innen ob Student*innen oder nicht nur allzu gut nachempfinden können. So wie die Geschichte vieler Studierenden, beginnt auch die von Gisela. Sie zieht wegen zu schlechter Abinoten und den billigen Mieten hier her. Chemnitz und der Studienanfang bedeuten für sie Neuanfang, alles auf null. Mit der Zeit entdeckt Gisela die schönen Ecken der Stadt und findet Freundinnen mit denen sie alles gemeinsam durchsteht. Von wilden Partynächten, ja auch die gibt es hier, über Demonstrationen gegen rechts oder auch die erste Abtreibung. An vielen Passagen des Buches fühlt man sich abgeholt. Egal ob es der Bazillentunnel ist, durch den man vor allem nachts lieber rennt als schlendert oder tröstliche Kuchengespräche bei Emmas Onkel. Irgendwann hat sich Gisela so richtig eingelebt und eines morgens beim Katerfrühstück kommt ihr die Blitzidee mit ihren Freundinnen eine Frauenband zu gründen. Als „Superbusen“ touren sie gemeinsam durch ein paar Städte, versuchen mit dem was sie machen etwas zu bezwecken, sich auszuleben und glücklich zu werden. Daran hat die Musik ihren Anteil, aber auch die Rebellion gegen die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt. Wenn Paula Irmschler eins schafft, dann ist es in nur einer Geschichte Popmusik, Feminismus und Politik so zu vereinen, als würde man gerade gemeinsam in der WG-Küche nach einer durchzechten Partynacht Gespräche führen, die ehrlicher nicht sein könnten. Gespickt wird die Geschichte mit der ein oder anderen Songzeile von stadtbekannten Musikern und Bands. Doch wo bleiben dabei die Frauen? Warum kommen diese in einem feministischen Buch nicht vor, wenn doch das zum Problem der Unterrepräsentiertheit beiträgt. Auch die Chemnitzer linke Szene, die verschiedene Ecken der Stadt bunter strahlen lässt mit Küfa über politische Vorträge und Aktionen bleibt in der Geschichte außen vor. Dennoch ist es ein reales Bild, welches die Autorin zur Stadt zeichnet. Es zeigt die Chemnitzer Hassliebe in all seinen Facetten. Alle Weggezogenen werden mit dieser Geschichte in Melancholie schwelgen. Alle Hiergebliebenen werden sich fühlen, als könne Paula zum Teil Gedanken lesen, zumindest wenn sie keine Insider*innen sind. Superbusen ist eine Liebeserklärung an Chemnitz, die abgefuckter und wahrer nicht sein könnte. Denn das was hier passiert ist oft scheiße, teilweise gut und die Mischung ist eine, die man anderswo vermissen wird. Zumindest für eine Weile.
Text: Svenja Jäger
Bild: Julia Küttner
Die Party ist vorbei und das ist okay
Als ich Anfang Februar ziemlich nebenbei zum ersten Mal vom Coronavirus gehört habe, hätte ich – wie höchstwahrscheinlich niemand von uns – auch nur ansatzweise ahnen können, dass diese Epidemie, die “so weit weg” stattfindet, dermaßen Einfluss auf unser Leben nehmen wird. Bei all den Neuigkeiten zu der Krise, die uns täglich erreichen, bin ich bin ernsthaft schockiert darüber, wie in Deutschland damit umgegangen wird.
Hier auf Zypern, wo ich mich momentan im Auslandssemester befinde, ging alles sehr schnell: am 9. März wurden die ersten beiden Fälle bestätigt. Einer davon in Limassol, der Stadt, in der ich studiere, der andere ein behandelnder Arzt aus Nikosia. Am 10. März hat gleich das uniinterne Fitnessstudio dicht gemacht, ab dem 12. März die ganze Uni (hier läuft das Sommersemester von Januar bis Mai). Gefühlt gestern war ich noch in der Uni, heute finden die Seminare in Videokonferenzen daheim statt, Prüfungen und Projekte wurden umstrukturiert. Bis zum Ende des Semesters werde ich die Cyprus University of Technology nicht mehr betreten. Die Folgen der Corona-Epidemie haben schneller in unseren Alltag eingegriffen, als wir uns umsehen konnten. In der gleichen Woche am Samstag wollte eine Freundin ihren Geburtstag in ihrer Wohnung feiern. Am Dienstag saßen wir noch zusammen in einem Restaurant. Sie hat Coronabedingt für Samstag nur sehr wenige Leute eingeladen, und selbst diese wenigen Leute haben alle abgesagt, weil sie die öffentlichen Verkehrsmittel meiden wollten, inklusive mir. Eine Spanierin, die eingeladen war, schrieb im Facebook-Gruppenchat, dass ein Bekannter von ihr mit hohem Fieber aus Abu Dhabi nach Limassol zurückgekehrt ist, ob er Corona hat, war nicht klar, weil es im Krankenhaus in Limassol keinen Corona-Test gibt, dafür müsste er nach Nicosia fahren.
Jeder von uns könnte das Virus unbemerkt in sich tragen
Da wurde mir bewusst: es könnten hier bereits unzählige Leute herumlaufen, mit ihren Händen die Haltestangen in den Bussen umgreifen, mit ihren Fingern ihren Pin in Bankautomaten tippen, die Tomaten am Gemüsetand abtasten, die mit Corona infiziert sind, und es noch nicht wissen. Oder Kontaktpersonen von Leuten, die nicht getestet wurden, weil die Ausstattung der Arztpraxen selbst in einer für zypriotische Verhältnisse größeren Stadt wie Limassol einfach nicht ausreicht. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts hält für wahrscheinlich, dass ungefähr die Hälfte der Infektionen in Deutschland aufgedeckt werden können – was bedeutet, dass die Zahl der tatsächlich Infizierten doppelt so hoch sein müsste wie die offizielle “Fallzahl”. Auf Zypern ist die Dunkelziffer wahrscheinlich noch um ein vielfaches höher.
Aber was mich wirklich geschockt hat, ist der deutsche Umgang mit der Epidemie. Am gleichen Tag, als ich eigentlich auf dem Geburtstag einer Freundin hätte sein sollen, schickten meine Eltern mir Bilder davon, wie sie in einem großen (leeren) Kaufhaus shoppen waren. Ich sah Stories mit “Coronapartys”, Menschen in Cafés und Menschen die durch Deutschland reisen und sich tätowieren lassen oder Freundinnen besuchen, als wäre nichts gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt gab es bereits über 2000 Fälle in Deutschland und circa 20 auf Zypern. Am Montag wurde Zypern quasi lahmgelegt, alle öffentlichen Freizeiteinrichtungen, touristischen Sehenswürdigkeiten, Hotels, Cafés und Restaurants geschlossen. Seit Sonntag dürfen keine Leute mehr ohne triftigen Grund einreisen. Wir gehen seit letzten Donnerstag noch zum einkaufen raus, oder zum frische Luft schnappen. Mein Instagram ist geflutet mit #stayhome und #selfisolation-Posts. Ich habe meine Freunde, die teilweise bereits abgreist sind, seit einer Woche nicht mehr gesehen.
Deutschland und seine Einwohner*innen reagieren viel zu langsam
Währenddessen vervielfachen sich die aufgedeckten Fälle in Deutschland täglich, doch erst seit wenigen Tagen fangen fangen die Cafés und Restaurants an, dichtzumachen. Die TU-Mensa hat erst am 18. März (!) ihren Betrieb eingestellt, als bereits 16 Fälle allein in Chemnitz offiziell bekannt waren. In meiner Zeit in der Wohnung in Limassol wird mir im Kontakt mit Leuten in Deutschland zunehmend klar, dass dort eine andere Perspektive auf die Epidemie vorherrscht, vielleicht geschuldet durch die unterschiedlichen Filterblasen in denen wir leben. Weil sich hier der Alltag so schlagartig verändert hat, nehmen hier die Leute die Krankheit auch etwas ernster, so lautet meine Theorie. Weil hier das öffentliche Leben so abrupt lahmgelegt wurde und unsere Freund*innen, Besucher*innen und Tourist*innen plötzlich Probleme haben, heim zu fliegen oder überhaupt vom Fleck zu kommen, gehen uns die Ausmaße der Epidemie etwas mehr zuleibe. Da in Deutschland ja sowieso Semesterferien sind, und manche Cafés und Restaurants noch offen haben, geht da der Alltag ein bisschen lockerer voran. Außer dass ein paar Clubs zu gemacht und Konzerte abgesagt wurden und man seine Hausarbeit nicht mehr in der Bib schreiben kann, hat sich allen Anschein nach kaum was geändert. Vor allem bei den jüngeren Leuten, die nachweislich die Hauptträger des Viruses sind. Dabei bedeutet genau deswegen für uns Unifrei nicht gleich mehr Zeit zum shoppen gehen oder Freunde treffen, sondern schlicht und einfach: zuhause bleiben.
Leute, die noch unnötig rausgehen, verleugnen Fakten
Fast im Stundentakt checke ich die Entwicklung der Fälle in Deutschland und überlege ernsthaft, ob ich noch nach Hause kommen möchte. Wieso hat Deutschland, das so stark vom Virus betroffen ist, so verdammt langsam reagiert? Könnte es eventuell etwas damit zutun haben, dass hierzulande wirtschaftliches Wachstum allem Anschein nach wichtiger ist als das wohl der einzelnen Bürger? Fast stündlich ploppen Eilmeldungen auf meinem Handy auf. Man braucht nicht lange in den einschlägigen Nachrichtenportalen herumzubrowsen, es ist klar: alle müssen zusammenarbeiten, um die Ausbreitung des Virusses zu stoppen und tausende unnötige Tode zu vermeiden. Und jede*r einzelne kann sehr einfach dazu beitragen, in dem er/sie sich vom öffentlichen Leben und gesellschaftlichen Zusammenkünften fern hält.
Junge Menschen, die sich jetzt immernoch in Parks treffen und Hauspartys schmeißen, verleugnen wissenschaftliche Fakten genauso wie die von ihnen verpönten Klimawandelleugner und Flat-Earther. Sie sind kein Stück besser. Diese Menschen belasten für ihr eigenes, egoistisches Vergnügen das Gesundheitssystem und könnten im allerschlimmsten und nicht ganz unwahrscheinlichen Fall für den Tod einer geliebten Tante, Freund, Mutter oder Großvater mit verantwortlich sein.
Mein Erasmus-Semester ist vorzeitig vorbei, aber ich werde mich nicht beschweren. Es gibt so viele Menschen da draußen, denen es schlechter geht als mir, die ernsthaftes Leid von dieser Krise davontragen, die unter überlasteten Krankenhäusern leiden oder bei denen ein geliebtes Familienmitglied im Sterben liegt. Das mindeste, was da von der fitten und jungen Bevölkerung (aka. “iCh bIn KeInE rIsIkOgRuPpE” aka. “iSt DoCh NuR eInE eRkÄlTuNg”) zu erwarten ist, mal für ein paar Wochen alleine zuhause zu bleiben. Ist das echt zu viel verlangt?
Text: Julia Jesser
Illustration: Julia Küttner