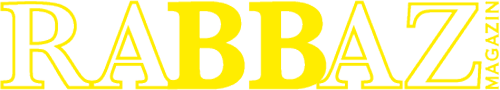In diesem kritischen Essay vermischen sich abstrahierte Eindrücke des Theaterstücks „Die Zwölf Geschworenen“ mit dem Versuch einer Einordnung der anklingenden Themen Demokratie, Dialog und menschliche Erfahrung.
Continue readingResilienz — eine Erfolgsgeschichte der Symptombekämpfung?
Resilienz erobert die gesellschaftliche Entwicklung im Sturm. Sie gilt als eine nicht
mehr wegzudenkende Fähigkeit in Anbetracht einer Zeit, die von Krisen und
Unsicherheit geprägt ist. Doch wo bleibt hier die Verantwortung für die Veränderung der
Ursachen, wenn wir von einer krisenbehafteten Umwelt ausgehen, an die wir uns
anpassen müssen?
Basketball ist der Beste Sport der Welt
Neue Sachen auszuprobieren ist wichtig für die persönliche Entwicklung und weil ich gerne meine Erlebnisse teile wurde daraus ein herzlich, ironischer Text aus dem man nie herauslesen könnte, dass ich nicht weiß wovon ich rede. Es geht um Basketball und den Spirit des wahrscheinlich coolsten Ballsports der Welt.
Continue readingGlitzer, Glanz und Gloria oder Folter, Kastration und Todesstrafe?!
*****Triggerwarning: Diskriminierung, Hate-Crime, Folter, Todesstrafe******
In allen öffentlichen Einrichtungen, den Fenstern deiner Stadt und den Logos aller Unternehmen findest du Regenbögen. Aus sämtlichen Ecken deines Stadtparks, in den Clubs und dem Schlafzimmer deiner Nachbar:innen erklingen Britney Spears, Lady Gaga, und Girl in Red. Und irgendwie laufen permanent viele glitzernde Menschen in unterschiedlich bunten Flaggen mit “Love is Love”-Schildern durch die Straßen. Das kann ja nur Eines bedeuten: Richtig, es ist wieder Pride Month.
Für all diejenigen, die noch hinter dem Mond leben: Während des Pride Months kommen mehr oder weniger weltweit Menschen zusammen, die sich dem LGBTQIA+- Spektrum zugehörig fühlen. Sie feiern die Freiheit, sie selbst sein zu können und die Personen zu lieben, die sie wollen, unabhängig vom Gender*. Der Pride Month ist in der Theorie eine Aneinanderreihung an Parties, Lebensfreude und Liebe. Aber eben nur in der Theorie.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt… oder so. Der ursprüngliche Gedanke des Pride Month ist zwar die Feier der unbedingten Liebe und Sichtbarkeit, dennoch wird dieser oftmals von kapitalistischen Grundgedanken überschattet.**
Abgesehen davon haben wir im Juni das Gefühl einer heilen Welt, in der alle leben und lieben dürfen, wen und wie sie wollen. In Deutschland wird Homosexualität nicht mehr bestraft (allerdings auch erst seit 1994 nicht mehr) und gilt auch nicht mehr als psychische Krankheit (auch erst seit Ende der 70er Jahre). Menschen in Deutschland dürfen sich seit 2017 aussuchen, wen sie heiraten, egal ob Frau, Nicht-Binär oder Mann [1].
Queere Personen werden also gar nicht mehr diskriminiert. Schon gar nicht in der westlichen Welt.
- Oder?
Leider ist das nicht der Fall. Während wir oftmals, und nicht nur im Juni, das Gefühl haben, dass die Gesellschaft im Jahr 2022 nicht-heteronormative Lebensformen akzeptiert, so sieht die Realität anders aus. Wir haben im Folgenden wichtige Studienergebnisse für euch zusammengefasst:

Während in Deutschland im Juni Regenbogenflaggen gehisst werden, werden andere Menschen in einem Großteil der Welt für ihre sexuelle Orientierung weiterhin diskriminiert, ausgeschlossen und bestraft. Dazu gehört im Übrigen auch das vermeintlich fortschrittliche Amerika. Der Westen, so sehr er sich selbst oft feiert, ist gar nicht so Queer-Freundlich wie er eigentlich sein sollte.
So soll es zum Beispiel in Florida ab Juli, passend zum Ende des Pride Month, ein Gesetz geben, dass es verbietet in Schulen über Sexualität und Gender-Identitäten aufzuklären. Begriffe wie Trans, Bi, Schwul oder Lesbisch sollen dabei in Klassenzimmern bis zur 2. Klasse verboten werden. Sollte eine Lehrkraft diese Wörter doch im Unterricht verwenden, können die Eltern der Kinder die Schule verklagen [4]. Eine harte Realität in der Nation, die sich selbst als “Land der Freiheit” bezeichnet.
Die Begründung des Gesetzentwurfs liegt in der Angemessenheit. Hierbei wird argumentiert, dass es unangemessen und verwirrend sei, Zweitklässler:innen Sexualität und Gendern näherzubringen. Auch nicht-binäre Geschlechtsidentitäten sind unerwünscht im Klassenzimmer, weil Darstellungen nicht-binärer Personen bei den Kindern für Zweifel sorgen sollen [5].
“Worin liegt die Relevanz für die Mehrheit der Bevölkerung? Warum betrifft das auch mich als nicht-queere Person?”
Stellen wir uns vor, es gäbe einen Gesetzesentwurf, der das Schulfach Mathematik und die Verwendung des Dreisatz verbieten würde. Natürlich echauffieren wir uns täglich darüber, dass wir seit der Oberstufe weder Kurvendiskussion noch Integralrechnung verwendet haben. Dennoch wären vermutlich wenig Menschen über einen Verbot des Schulfachs erfreut.
So ähnlich ist es auch bei dem Grundwissen rund um Themen der sexuellen Orientierung, Genderidentität usw. Ja, vermutlich wirst Du als heterosexuelle cis-Person wenig direkten Gebrauch im Umgang mit Dir selbst davon machen.
Stell dir aber einmal vor, du dürftest nicht über deine Eltern reden, über deine Geschwister, deine Großeltern, bzw. ein Familienmitglied sprechen. So geht es bald Kindern mit Familienmitgliedern aus der LGBTQIA+-Community in Florida. Sie dürfen dann nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt über Familienausflüge, Geburtstage oder Feiertage berichten bzw. nur eingeschränkt. Was macht das mit einem Kind?
Stell Dir vor, du dürftest nicht über das reden, was dich zum Teil als Person ausmacht, worüber du dich definierst und was wie Herz und Hirn zu dir gehört. Würde es dir gut gehen?
Vermutlich eher nicht.
Stell Dir vor, du würdest von Anfang an in der Schule das Gefühl vermittelt bekommen, dass so wie Du vielleicht bist und wen du liebst, es nicht “richtig” ist.
Stell Dir vor, du wirst für etwas verurteilt wofür du nichts, aber auch gar nichts kannst und woran du auch nichts ändern kannst.
Wir, die Autor:innen können an dieser Stelle mit Herzblut sagen, dass ein offener und wertschätzender Umgang mit Sexueller Orientierung und Genderidentität uns etliche Jahre an Selbstreflexion, Hinterfragen, Schlaflosigkeit und auch Scham erspart hätte.
Neben einem Westen, der sich gern ein Regenbogen Cape umhängt und “stolz” in die Sonne lacht, gibt es noch das genaue Gegenteil: die Staaten, in denen Du für deine Sexuelle Orientierung verfolgt wirst und neben Peitschenhieben und Gefängnisstrafen auch mit dem Tod bestraft wirst.
Yulia Tsvetkova, eine russische Aktivistin, Künstlerin und Theaterregisseurin wird wegen ihrer selbst erstellten Kunst und Arbeit ständig belästigt. Neben Morddrohungen per Telefon und Brief, hat auch die russische Regierung ein großes Problem mit der Arbeit Tsvetkovas [6].
Seit 2019 wird Tsvetkova u.a. wegen der Vulva-Zeichnungen strafrechtlich verfolgt. Ihr wird vorgeworfen gegen §21 des Gesetzbuches für Ordnungswidrigkeiten zu verstoßen. Die Zeichnungen werden als “homosexuelle Propaganda” betitelt. Weiterhin wirft man Tsvetkova vor, Werbung für homosexuelle Beziehungen über Social-Media-Kanal VKontakte zu machen; laut russischem Gesetz strafbar, wenn es an Minderjährige gerichtet ist. Der Kanal ist aber mit 18+ gekennzeichnet, und somit gesetzeskonform.
Nach §242 (3b) beschuldigt man die Aktivistin der Herstellung und Verbreitung pornografischen Materials. Damit sind ihre Zeichnungen des weiblichen Körpers gemeint, um die Rolle der Frau in den sozialen Medien zu stärken.
Trotz all des Gegenwinds den Yulia Tsvetkova erfährt, hat sie ihre Arbeit noch nicht aufgeben und unterstützt die LGBTQIA+- Community weiterhin unermüdlich mit ihrer aufklärenden Kunst.
Falls ihr Interesse habt euch näher mit ihrer Kunst auseinander zu setzen könnt ihr hier vorbeischauen.
Die Anschuldigungen gegen Tsvetkova sind oft nicht richtig vom Gesetz gestützt oder werden aufgebauscht. Mit ihrer Arbeit versucht Tsvetkova lediglich Menschen zu helfen und über das Facettenreichtum sexueller Orientierung aufzuklären.
Neben heftiger Kritik an LGBTQIA+-Aktivist:innen ist auch die Pride Parade unerwünscht in Russland. Das Event ist in Russland schon seit längerem Angriffen ausgesetzt, noch dazu erfahren die Teilnehmer:innen und Organisator:innen heftige Kritik von Moskauer Bürgermeister Yuri Luzhkov, der ein Verbot der Pride Parade fordert. Zum ersten mal fand die Parade 2006 statt, damals noch in sehr kleinem Rahmen. Die Demonstrierenden versammelten sich vor dem Kreml und verlangten eine bessere Behandlung von LGBTQIA+ sowie Gesetzesanpassungen. Die letzte offizielle Pride Parade fand 2011 statt und wurde bereits nach wenigen Minuten von Gegner:innen der Bewegung boykottiert. Jedoch gibt es natürlich immer noch queere Veranstaltungen [8].
Das Attackieren und Boykottieren einer der wichtigsten Veranstaltungen für die queere Community ist mehr als ein Armutszeugnis. Es wird deutlich, dass Russland weder die Aufklärung über LGBTQIA+ noch die Community an sich unterstützt. Umso wichtiger ist es von Außen zu helfen und den queeren Menschen in Russland zu zeigen, dass sie trotz aller Kritik nicht alleine sind.
Ein weitaus düsteres Bild zeichnet sich im Iran ab. Dort wurde ein:e LGBTQIA+ Aktivist:in mit der Todestrafe bedroht. Zahra Sedighi-Hamadani ist eine Gender-Nonkonforme Aktivist:in, welche:r in einem Iranischen Gefängnis nähe Urmia für Sexualität, Geschlechtsidentität und Aufklärungsarbeiten festgehalten wurde. In Gefangenschaft war Sedighi-Hamadani intensiven Verhören durch die Revolutionsgarde ausgesetzt. Beleidungungen, Beschimpfungen, Drohungen der Todesstrafe – alles aufgrund der reinen Identität.
Die Anschuldigungen lauten: Förderung von Verdorbenheit auf Erden und Kommunikation mit Medien der Gegner der Islamischen Republik Iran sowie Förderung des Christentums [7]. Außerdem musste Zahra Folter, die u.a. Elektroschocks, Schläge und verlängerte Einzelhaft umfasste, durchstehen – Taten, die gegen das uneingeschränkte Verbot von Folter und anderen Handlungen verstoßen [9].


Dies sind einige, aber leider noch lang nicht alle Beispiele von Diskriminierung und Gräueltaten, die queere Menschen durchleben müssen. Oft wird die LGBTQIA+-Community als ein Haufen glücklicher und glitzernder Paradiesvögel wahrgenommen. Während das für einige glückliche Personen vielleicht der Fall ist, so sieht die Realität für viele Mitglieder der Community anders aus. Hass auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlich starken Ausprägungen steht nach wie vor an der Tagesordnung.
Es reicht nicht, einmal im Jahr einen Monat zu haben, in dem Regenbögen das Zentrum der Aufmerksamkeit sind.
Es reicht nicht, wenn Du als vermeintlicher Ally in queere Clubs gehst, weil Dir die Musik und die Stimmung besser gefällt.
Es reicht nicht zu sagen, dass das eigene Land ja vermeintlich weit ist, weil es ja die “Homoehe” gibt.
Solang Personen auf Basis ihrer Gender-Identität und der Personen, die sie lieben, diskriminiert, verfolgt, gefoltert, und ermordet werden, sind wir weit weg von einer Gesellschaft, die sich als fortschrittlich bezeichnen darf.
Reflektiere Deine Internalisierten diskriminierenden Gedanken und Stereotype.
Informiere Dich. Bilde Dich fort. Hab ein bisschen mehr Verständnis.
Werde aktiv als Ally und steh hinter den queeren Menschen.
Begegne Menschen mit Respekt, Offenheit, Empathie und Wertschätzung.
Autor:innen: Hanna Kalf & Ilka Reichelt
Design/Illustration: Annabella Bauer, Hanna Kalf, Ilka Reichelt
********************************************************
*Mehr Details sowie Projekte in Sachsen findest Du hier: https://rabbaz-magazin.de/lgbtq-god-save-the-queer/
**Der vorliegende Artikel konzentriert sich weniger mit der kapitalistischen Ausnutzung des Pride Month. Sollte Dich das interessieren, empfehlen wir Dir an dieser Stelle folgenden Artikel: https://rabbaz-magazin.de/alle-jahre-wieder-heucheleimonat/
Mehr Informationen findet Ihr hier:
Instagram-Accounts für mehr Awareness:
@lesbian_herstory
@pride
@flinta.jam.chemnitz
@vulva_me
(@catcallsofchemnitz)
@faemm.fm
TikTok:
@dylanmulvaney
@transtopia
@mitreden
@rivka.reyes
@mamajillwallace
@kissyduerre
Quellen:
[1] https://handbookgermany.de/de/rights-laws/lgbtiq.html
[2] https://www.wien.gv.at/menschen/queer/pdf/eu-lgbt-survey.pdf
[4] https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/florida-sexuelle-orientierung-101.html
[7]https://www.queeramnesty.de/aktionen/detail/2022/iran-lgbti-aktivistin-droht-todesstrafe
[8]https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Pride#Moscow_Pride_2011
[9]https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/folterverbot/
https://www.lsvd.de/de/ct/2445-Homophobe-Gewalt#wie-viel-hasskriminalitaet-gegen-lsbti
https://hatecrime.osce.org/russian-federation
https://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualität_in_Tschetschenien
Die Hälfte der Schönheit oder doch die Ganze?
Ein Gastbeitrag von Eslam Krar über seine Identität als Schwarzer nubischer Herkunft und Rassismus. In Prosaform setzt er sich hier mit der Geschichte seiner Familie auseinander. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden wegen dem Bau eines Staudamms in Assuan, Ägypten nubische Anwohner:innen aus ihren Dörfern vertrieben. Ihre Dörfer wurden überflutet – und damit auch ein großer Teil ihrer kulturellen Errungenschaften. Das Versprechen der aktuellen ägyptischen Regierung, den Nubier:innen ihr Land zurück zu geben, wurde bislang nicht eingelöst.
In einem nubischen Dorf, das vor der Vertreibung seiner Bewohner:innen im Herzen von Assuan lag und sich jetzt außerhalb seiner Grenzen befindet, bestehend aus zwei Bahnhöfen und Häusern mit Schlammwänden, die jedes Mal bröckelten, wenn wir uns darauf stützten, legte ich meinen Kopf auf die Schulter meiner Großmutter. Ich hatte sie sehr vermisst, als ich zur Jahresmitte auf die Ferien gewartet habe, um nach Assuan zu reisen und bei ihr zu bleiben.
In den Schulferien, die ich in Assuan verbrachte, beschäftigte ich meine Großmutter mit vielen Fragen und mehreren Vergleichen: „Warum sind die Häuser hier nur ebenerdig?“ „Warum sagen die Kinder in der Schule ‚Nina‘, wenn sie über ihre Omas sprechen und nicht ‚Seti‘?“ „Warum nennt mich hier niemand ‚Schokolade‘?“ Ich wusste auch nicht, warum sie glaubten, dass mich diese Bezeichnung ärgern würde.
Die Flut von Fragen überstieg die Energie und die Sprache meiner Großmutter. Sie wechselte zwischen nubischer Sprache und ägyptischer Umgangssprache mit nubischem Akzent, um meine Fragen zu beantworten. Mit ihrem großen schwarzen Schal, den sie mehrmals um sich gewickelt trug, wischte Sie mein Gesicht ab und sagte dabei Worte wie „Schokolade“, „Schwarzer“ und “haben sie dich im Ofen vergessen, oder was?“
Sie hielt meine Hand und wir gingen zusammen barfuß über den Sand unseres Dorfes. Der Sand des Dorfes kannte sie gut und tat ihr nicht weh, und vielleicht, um sie zu ehren, tat mir der Sand auch nicht weh.
Sie riet mir: ”Wenn jemand zu dir Schwarzer sagt, frag ihn: „Hältst du dich vielleicht für eine Herbstrübe?*“ Meine Großmutter wiederholte diesen Satz und ich verstand seine Bedeutung nicht, und wegen seiner ironischen Ernsthaftigkeit war ich nicht daran interessiert, nach seiner Bedeutung zu suchen. Vielleicht hatte ich das Gefühl, dass es für jede:n Weiße:n schwierig war, einer Herbstrübe zu gleichen. Einmal fragte ich meine Oma, ob wir Herbstrüben seien. Daraufhin lachte sie laut und hielt sich verschämt die Hand vor den Mund, um die im Laufe der Zeit entstandenen Zahnlücken zu verstecken. Sie sagte dann zu mir: „Nein, wir sind Schokolade, leider, wir man so sagt, aber Schokolade ist teurer als Milch!“
Zuhause
Ich stand früh auf, um den Duft des Brotes zu riechen, das meine Großmutter vor Sonnenaufgang gebacken hatte. Der Geruch vermischte sich mit der kühlen Morgenbrise, als würde meine Oma den Morgen für uns backen und nicht nur das Brot. Ich stand im Hof des Hauses, dessen Wände mit blassen Mustern und Farben nubischer Herkunft übersät sind. Dort blickte ich auf ein Bild mit zerbrochenem Rahmen. Es zeigte meinen Großvater, als er Mitte vierzig war. Dann fiel mein Blick auf ein Porträt meiner Großmutter, das sie in ein Loch in der Wand gestellt hatte. Es stand neben einigen teuren Töpfergefäßen und war von Baumblättern umgeben. Ich weiß nicht, ob meine Großmutter die Blätter hingelegt hatte, oder ob sie von selbst mit dem mit Brotduft beladenen Wind gekommen sind, um das Bild zu schmücken. Der Hof des Hauses ist nicht überdacht und ich konnte direkt in den Himmel schauen. In einen Himmel, der Wolken über das Haus ziehen lässt, um uns vor den Sonnenstrahlen zu schützen.
Nichts in diesem Haus erinnerte an die Geschichte, die wir aus der Schule kannten, denn auch meine Großmutter musste sich nach der Vertreibung von der Geschichte lösen: In ihren schwarzen Gewändern trug sie auf der Flucht Teekannen, Kochutensilien und Maiskörner. Die Maiskörner nahm sie als Erinnerung mit und in Dankbarkeit für ihre landwirtschaftlichen Ernten, die mit dem Jubel eines hungrigen Volkes und der Hoffnung auf eine Zukunft im Wasser des Staudamms ertrunken waren. Diese Erinnerung an das Volk der Nubier:innen musste sie töten.
Der Esel
Das Radio lieferte den Soundtrack zu den Szenen im Haus meiner Großmutter. Vielleicht hat die Koran-Sure mit dem Backen, dem Geruch von kochenden Bohnen und dem Geräusch des Klopfens meiner Großmutter an die Tür des Kükenzimmers** ganz automatisch harmoniert. Diese Harmonie wurde in der Nachrichtensendung durch das Wort „Produktionsrad“ gestört, das wiederum vom Eintreten meines Onkels samt dessen Esel begleitet wurde. Ein Mann im Alter von etwa siebzig Jahren kam mit einem Baumstamm herein, den er als Gehstock verwendete und einem Esel, der ihm näher als alle Menschen stand. Der Onkel wusste nichts von Tierrechten und hatte noch nie an einer Versammlung teilgenommen, um für die Rechte der Pinguine in der Arktis zu kämpfen, aber er freundete sich instinktiv mit Tieren an. Der Onkel lernte von klein auf nach der Schule der Maliki und arbeitete an deren Rechtsprechung mit. Die Madhhab von Imam Malik ist eine Rechtsschule, der die Menschen im Süden Ägyptens und in fast allen afrikanischen Ländern folgen. Ausnahmen sind einige Länder an der Ostküste Afrikas, wie Somalia, das in der Nähe des Jemen liegt und deshalb der jemenitischen Schafi’i-Schule angehört. Nach dem Tod meines Onkels stand der Esel vor der Tür des Hauses und wartete darauf, dass mein Onkel in den Schuppen ging. Er kam aber nicht und so blieb der Esel die ganze Nacht bis zu seinem Tod stehen. Dieser trat eine Woche später ein, nachdem Verwandte versuchten, ihn mit Gewalt von seinem Platz zu bewegen.
Revolution und Widerstand
Der Geruch des Gases auf dem Tahrir-Platz während der Januarrevolution erreichte Nubien nicht, die Nubier:innen gingen nicht auf die Demos, um den Sturz des Regimes zu fordern. Sie fühlten sich diesem Staat nicht mehr zugehörig, aber die Bindung an das versunkene Erbe und an das gestohlene Land blieb ebenso wie das Volk, das Abdel Nasser zugejubelt hatte und ihn noch wegen des hohen Damms bejubelte. Mit großer Begeisterung erzählte ich meiner Großmutter von der Revolution und den Geschehnissen, und sie wiederum erzählte mir, dass die Dorfjugend vor dem Gouvernementsgebäude Zelte aufgebaut hatte, um das Recht auf Rückkehr in unser Land einzufordern. Man kann also nicht behaupten, dass die gesamte neue Generation das gleiche Ziel verfolgte: während die Älteren den Traum von Rückkehr und Umsiedlung in ein ähnliches Land nicht aufgeben konnten, lagen zumindest die Positionen der Jüngeren zwischen denen, die das gesamte Erbe des Traums übernahmen und ihn durch Sitzstreiks und Proteste verteidigten und anderen wie mir, die nichts von diesem geraubten Recht gewusst hatten, weil sie in den Massen von Kairo inmitten der Kämpfe um ihre eigene Existenz lebten.
Der „trockene Osten“
Vor kurzem habe ich das Mittelmeer überquert um nach Ostdeutschland zu ziehen. Ich wusste sehr gut, dass das Leben im Osten nicht einfach ist, aber ich hatte keinen blassen Schimmer wie es wirklich sein würde. Bevor ich in den „trockenen Osten“ zog, wie ein Freund von mir ihn nannte, besuchte ich in Bremen, einer Stadt im Norden, ebendiesen Freund. Er erzählte mir, was er über den Osten gehört hatte, und ich pflegte sarkastisch zu sagen, dass dadurch, dass ich „Muslim/Araber/Schwarzer“ bin, der Rassismus verdreifacht würde.
Furcht machte sich in meinem Kopf breit und Angst stieg in meinem Herzen auf, als ich im Innenhof der Universität Bremen ein Schild mit der Aufschrift „Nazis in Sachsen“ neben mehreren Schildern mit anti-rassistischen Worten las; es war an dem Tag, bevor ich in den Osten reiste.
In Deutschland habe ich mehrere rassistische Situationen erlebt, an die ich mich nicht mehr erinnern möchte, mein Wortschatz könnte mir nicht helfen, alles auszudrücken… Ich versuche sie aus meinem Gedächtnis zu löschen, indem ich nach positiven Erlebnissen in meinem Tag suche und jeden Tag eine Stunde lang lese; das ist die Zeit, die der Zug braucht, um mich zum Deutschkurs zu bringen. Manchmal vergeude ich die Stunde, ohne zu lesen, wegen des Anblicks der grünen Felder, die zu einem völlig ausgebleichten Stück Land geworden sind. Oder damit, eine Mutter zu beobachten, die versucht, die Ekstase ihres Kindes einzufangen, das nach Farben, Regen, Schnee und dem Zug fragt. Aber auch wie dieses Kind wegen meiner Hautfarbe irritiert ist, die Verlegenheit der Mutter sowie ihre Versuche, die Aufmerksamkeit ihres Kindes auf etwas Anderes zu lenken. Mich stören die rassistischen Worte über meine schwarze Farbe überhaupt nicht. Ich denke an die Antwort meiner Oma, als ich sie fragte: „Stimmt das, was sie mir sagen, Oma, dass Dunkelsein die Hälfte der Schönheit ist?“ Sie antwortete selbstbewusst: „Mein Kind, Dunkelsein ist die ganze Schönheit… nicht die Hälfte!”
*Eine Anspielung auf das dunkle, violette Außen und weiße Innere einer Herbstrübe.
** Ein Zimmer im Haus, in dem Hühner aufgezogen werden.
Text: Eslam Krar
Übersetzung: Jad TurJman
Bearbeitung: Julia Jesser
Bild: Eslam Krar/Jasmin Biber
Weitere Hintergrundinformationen zu der Vertreibung der Nubier:innen aus Assuan findest du hier.
Eine Reise von Hartz 4 nach Bafög
Klassismus. Nicht mal Word kennt diesen Begriff. Ich bin das erste Kind aus meiner Familie, das das Abitur geschafft hat und dann auch ein Studium erfolgreich abschloss. Es war eine lange Reise. Inzwischen bin ich aber in der Welt der Akademiker:innen angekommen. In einer Welt, die meinen Hintergrund aber nur theoretisch zu begrüßen scheint, praktisch soll ich ihn mir nicht anmerken lassen. Wenn mir das gelingt, bin ich aber unbedingt gewollt, denn die Chancengleichheit in Deutschland ist nach den OCED Studien von 2018 immer noch ausbaubedürftig und der Begriff Bildungsgerechtigkeit liegt in aller Munde. Klassismus ist laut Andreas Kemper und anderer Soziolog:innen ein riesiges Problem an deutschen Universitäten. Zugleich aber auch blinder Fleck.
Ich wurde in Berlin geboren, mitten in eine kunterbunte Patchworkfamilie. Wir waren viele Kinder, es war chaotisch, voll und lärmend. Mal zog ein Kind aus, ein neues tauchte auf, eins verschwand. Geld war meistens knapp. Manchmal kamen die gelben Briefe. Briefe, in denen sie uns mitteilten, dass sie kommen wollten, um uns alles wegzunehmen. Meine Mutter war seit der Wende arbeitslos. Mein Vater arbeitete damals im Krankenhaus in der Küche. Das war reine Plackerei, undankbar und hart und er wurde gemobbt. Aber er arbeitete immer gewissenhaft und wir waren stolz auf ihn. Er brachte uns oft mit, was auf den Essenstabletts der Patient:innen noch so übriggeblieben war. Joghurts, eingepackte Küchlein, ein paar Aufstriche. Es war das Highlight jedes Tages, beim Schlüsselklappern zur Tür zu stürmen und ihn aufgeregt zu fragen, was er heute für uns aus der Küche geschmuggelt hatte. Verboten war das natürlich. Damals erschien uns das sinnlos. Ein weiteres Diktat der Versicherungen, die sich nicht um die Kindermünder armer Arbeiter:innen scherten. Heute weiß ich um die Keime und Bakterien und mit welcher Abscheu das Pflegepersonal eben jenes übriggebliebene Essen behandelt, das wir strahlend an uns rissen. Ganz arm waren wir aber nicht. Zum Beispiel hatten wir auch öfter Schokoladencreme fürs Brot und wenn Geld zur Verfügung stand, wurde es in uns investiert. So erhielt ich einige Jahre Geigenunterricht. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, wurde ich oft nicht richtig satt. Und das Gefühl, so viel essen zu können, wie ich wollte, lernte ich erst in meinen Zwanzigern richtig kennen. Während mein Vater die Schule noch vor seinem ersten Schulabschluss abbrach und bis heute weder richtig schreiben noch lesen kann, weiß meine Mutter unglaublich viel. Aber sie war zuhause. Depression. Wir kannten das Wort Depression aber nicht. Wir nannten es „keine Lust zu arbeiten“ und waren manches Mal sauer auf sie. Wir Kinder beschäftigten uns mit uns selbst. Wir waren viel draußen und frei. Eigentlich war es egal, was wir machten, solange die Noten stimmten. Den ersten Polizeikontakt hatte ich mit sechs. Es hätte mit mir auch in eine andere Richtung gehen können. Dessen bin ich mir bewusst. Die Korrelate der Armut. Manche schenkten mir Abenteuerlust und die Möglichkeit, eigene Perspektiven zu entwickeln, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen und ohne großen familiären Druck. Andere wiederum waren nur schwer verdaulich und hinterließen Spuren.
Nun wird von einem jede Menge verlangt, wenn man das Milieu Richtung Mitte wechseln will. Es gibt so viel Neues, an das man sich erst gewöhnen muss. Da wäre zunächst das Offensichtliche. Die Orte der Gesellschaft, die Geld als wesentliches Medium der Zugehörigkeit verlangen. Wie Friseur:innenbesuche, Auto fahren, Sportvereine besuchen, Urlaub machen oder auch nur der regelmäßige Stopp beim Schnellimbiss. All der Luxus, aus dem eine Vielzahl von Menschen ausgeschlossen sind. Sich daran zu gewöhnen war schön, ja, es hatte etwas Befreiendes, manchmal aber auch Irritierendes. Zum Beispiel drehte sich das Tischgespräch bei unseren ersten familiären Restaurantbesuch ausschließlich darum, dass man unbedingt den Aschenbecher oder irgendetwas anderes stehlen müsste. 70 Euro für das Essen von fünf Personen zu verlangen empfanden wir als dreist. Neben diesen offensichtlichen Anforderungen gab es auch die Aufgabe, subtile Merkmale wie die Mimik und die Gestik – all das, was Bourdieu als den Habitus der Klasse beschreiben würde, anzupassen. Denn Umgangsweisen und die Art und Weise wie man sich nach außen hin gibt unterscheidet das Mittelklassenumfeld stark von dem, was ich gelernt habe. Diesen Bereich erlebe ich als veränderungsresistenter. Statt laut zu lachen, lacht man leise, ja fast anmutig. Nur nicht zu herzhaft. Man muss gebildet wirken und klug und diszipliniert und man muss sich gut artikulieren. Kritik äußert man höflich. Keine Wut und nicht streiten. Man soll leise sein, man… Das sind nur einige Beispiele für grundlegende Umgangsformen, die ich anders gelernt habe. Ich erlebe es wie eine andere Lebensrealität, eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires, die sich bis ins Kleinste definiert. Um die Metamorphose des klassenreisenden Individuums schließlich erfolgreich abzuschließen, muss auch der Geist mitkommen. Das Selbst muss angepasst, eine neue Identität entwickelt und in die Alte integriert werden. Glaubenssätze wie „Akademiker:in sein übersteigt meine Möglichkeiten“ oder „Dafür bin ich nicht klug genug“ müssen überwunden werden. Es ist ein Austritt aus dem kollektiven Denken der Familie.
Seit dem Eintritt in die Uni sind die Unterschiede zum Ausgangspunkt meines Weges maximal. Trotzdem habe ich mich selten schamerfüllter für meine Vergangenheit gefühlt. Ein Blick auf mich selbst, der von oben herab, mit Arroganz und Mitleid, auf meinen Background starrt und mit dem Kopf schüttelt. So als wäre das Milieu, in dem ich groß geworden bin, unterentwickelt. So als würde mir bis heute etwas fehlen. Ich schäme mich für meinen Fernseher an der Wand und achte darauf, dass er in den Onlinemeetings der Uni nicht zu sehen ist. In anderen Kreisen ist mir das egal. Selbst in Kreisen, wo noch mehr verdient wird, in dem die Leute noch „weiter oben“ sind. Warum im Unikontext nicht? Das hat viel mit mir zu tun, mit den Glaubenssätzen, die ich als Kind vermittelt bekommen habe. Aber auch mit dem, was ich im Unikontext erlebe. Ich habe kaum Kommiliton:innen in meinen Einskomma- NC Studiengang getroffen, von denen ich weiß, dass sie Ähnliches erlebt haben. Eigentlich nur Eine. Eine wütende junge Frau, die kein Bock auf „akademisches Gehabe“ hatte und das auch alle wissen ließ. Statistisch muss es sie doch aber geben. Immerhin sind nach der 21. Sozialerhebung ganze 48% der Studierenden nicht aus akademischen Verhältnissen. 21 % der Kinder aus Arbeiter:innenfamilien studieren. Aus den Hartz-IV-Familien sind es aber nur noch 10%. Zur letzteren Gruppe fühle ich mich zugehörig. 12 % bekommen Bafög. Nun aber, wo sind die anderen? Verstecken sie sich so gut sie können? Oder was ist da los? Was erleben sie so? Nicht ein einziges Mal in meinem zig Jahren Uniausbildung hatte ich dazu auch nur einen einzigen Austausch und es ist nicht so, dass das keine Rolle spielt. Es ist einfach so verdeckt und schambehaftet, dass man sich dazu nicht outet.
Manchmal ecke ich an, wenn etwas unpassend war. Dann gibt es genervte Blicke oder hochgezogene Augenbrauen und Abwehrhaltung, von Professor:innen und Studierenden. Kenne ich nur zu gut inzwischen und manchmal werde ich dann auch wütend. Es ist Seminar. Ich lache, fand etwas witzig. Abschätzige Blicke von Mitstudent:innen. Klar, gegenseitige Erziehung und Anpassung, um dem sozialen Raum Struktur zu geben. War wohl zu lebendig für den Kontext. Aha. Ich frage einen Professor energisch und aufgeregt nach einer offenen studentischen Mitarbeiter:innenstelle, die mich wirklich interessiert. Er schaut verärgert und irritiert, murmelt etwas von „Chancengleichheit“ und „E-Mail“ und schlägt mir die Tür vor der Nase zu. Den Job kriege ich sicherlich nicht. Ein andernmal bemerke ich, wie meine Gedanken nicht aufgegriffen werden. Ich weiß aber, dass sie klug sind. Ich merke, es liegt an der Ausdrucksweise. Ich bilde mir das nicht ein. Diese und ähnliche Momente gab es im Präsenzstudium ständig. Wenn über Menschen mit wenig Geld gesprochen wird, schwingt da oft so ein Mitleid mit. So ein „Ach, die Armen“. Irgendwie von oben herab. Das macht mich echt wütend. Es sind oft die systemischen Umstände, die zur Verarmung einer Vielzahl von Menschen beitragen. Jobs, die nicht gerecht bezahlt werden. Wir brauchen kein Mitleid. Empörung auf Augenhöhe wäre hilfreicher und respektvoller.
Ich nehme es den Einzelnen auch nicht übel. Ich trage auch jede Menge Vorurteile in mir selbst herum. Klassistische, sexistische und rassistische, und sicherlich jede Menge mehr. Trotzdem bin ich genervt und das ist gut so. Denn mein Habitus fühlt sich für mich hier ungewollt an. Ich fühle mich diskriminiert. Ich habe keine Lust mehr, meine Energie darauf zu verwenden, mich passgerecht in die Schablone von feinen Ärt:innentöchtern zu zwängen. Ich bin stolz auf meine Herkunft, die für mich auch eine andere Kultur bedeutet. Die Welt der Akademiker:innen, wie ich sie kennengelernt habe, ist schön, aber ein Mix aus beiden trifft doch eher meinen Geschmack. Ich durfte die Gesellschaft von mehr Seiten kennenlernen, als jemand, der „nur“ in Mamas Fußstapfen treten musste. Ich habe Flexibilität und echte Toleranz gelernt und kann mich problemlos mit Mitgliedern verschiedener Schichten auf echter Augenhöhe verbinden. Das sind nur einige der Qualitäten, auf die ich und andere Arbeiter:innen- und Hartz-IV-Kinder stolz sein können. Es ist Zeit, dass wir erhobenen Hauptes und mit aneckenden Gewohnheiten die Machtstrukturen, die durch die unsichtbaren Gesetze Bourdieus beschrieben werden können, zum Wanken bringen.
Ich wünsche mir von der Studierendengemeinschaft, dass die Existenz von Klassismus, also der Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit, mehr in das Bewusstsein rückt und seinen angemessenen Platz zwischen den anderen -ismen einnimmt. Ich hoffe, dass unsere Generation dazu beitragen wird, dass der Begriff Klassismus aus dem Wortschatz von Word nicht mehr wegzudenken ist.
Autorin: anonym
Grafik: Theresa @klein.kunst.kanal
Nasskalt.
*****Triggerwarnung: Psychische Erkrankungen, Depression*****
Hier ist er. Der Winter. Lange Nächte, kurze Tage. Die Farbe des Himmels wechselt die Grautöne, die Lage des Wetters wechselt zwischen bewölkt, windig, Schneeregen und Schnee. Ich starre durch das Fenster nach draußen und mache eine gedankliche Notiz, meine Tageslichtlampe zu reaktivieren.
“Mit Beginn des Novembers fühle ich mich auf seltsame Weise zu dem dunklen Teil meiner Garderobe hingezogen. Ich habe viel zu tun, aber bleibe lieber liegen. Statt nach dem ersten Klingeln des Weckers aufzustehen, drücke ich die Schlummertaste 100 mal und prokrastiniere so lang vor mich hin bis ich mir einreden kann, dass es eh nicht mehr viel bringen würde noch mit Unisachen anzufangen. Meine Konzentrationsfähigkeit sinkt auf ein Minimum, mein Kopf fühlt sich an als wäre er statt mit grauen und weißen Zellen mit Watte ausgekleidet.
Der Drang nach Veränderung wächst. Haare färben? Piercing? Tattoo? Küche renovieren? Neue Gardinen im Schlafzimmer? Ach, warum nicht einfach alles zusammen? Mit der Umgestaltung äußerer Umstände bzw. meiner äußeren Entscheidung verdränge ich meine eigentliche Unzufriedenheit, die sich aus den Tiefen meiner inneren Abgründe langsam nach außen frisst. Sie nagt, sie knabbert, sie kaut auf meiner Lebkuchenhausfassade herum. Die Löcher kann ich nur noch schlecht mit ein bisschen Puderzuckerguss und Gummibärchen flicken. Aber wer mein Haus kennt, weiß, dass die Fassade bröckelt. Fragen wie: “Wie geht`s dir?” oder “Alles in Ordnung?” kann ich nicht mehr weglächeln oder übergehen. Komplimente wie “Du siehst viel lebendiger aus!” nicke ich ab und denke mir meinen Teil. Ich fühle mich nicht lebendig. Das hier fühlt sich auch nicht wie mein Leben an, sondern nur so, als würde ich zusehen, daneben stehen und ein paar unqualifizierte Bemerkungen aus dem Off machen. Fühlen ist auch das falsche Wort. Ich fühle auch nichts mehr. Jedenfalls nicht so wie vorher. Vielleicht habe ich auch den Zugang zu meinen Gefühlen verloren. Ich weiß es nicht. Es ist alles so wie das Wetter, kurze Tage, lange Nächte, wechselnde Grautöne.”
Frau Krause schaut erst meine Betreuerin, dann mich an. Ihre Augen sind mit Tränen gefüllt, aber auffallend leer. Sie liegen tief in den Höhlen, ihre Wangen sind eingefallen. Sie sitzt nach vorn gebeugt, eher geknickt auf ihrem Stuhl, die Hände liegen in ihrem Schoß, sie nestelt an ihren Fingern herum. Der Monolog war die Antwort auf die Frage warum sie hier sei. Mit “hier” ist die ambulante psychotherapeutische Praxis gemeint, in der ich aktuell mein Praktikum absolviere. Frau Krause ist in einem ähnlichen Alter, irgendwo Anfang 20, irgendwo zwischen Studium, Nebenjob und WG- Leben. Wenn Frau Krause und ich uns nicht hier kennengelernt hätten, dann sicher auf einer Feier in einem der Studiclubs am Campus. Frau Krause und ich hätten Freundinnen sein können.
Aber hier sitzen wir. Drei Frauen in einem Raum, ein Zettel, ein Stift, eine Box mit Taschentüchern, eine Monstera in der Ecke. Man sieht Frau Krause an, dass es ihr nicht gut geht, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Die im Raum stehende Scham ist erdrückend. Frau Krause schämt sich dafür, hier zu sitzen. Bei Menschen, die ihr helfen können. Sie schämt sich, dass sie professionelle Hilfe bei ihren Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen, in ihrem Alltag braucht.
So viele Menschen schämen sich dafür, obwohl es ganz normal ist. So viele Menschen fühlen sich anders, nicht “normal” und wie ein Fehler im System. Scham und psychische Erkrankungen gehen Hand in Hand. Physische Erkrankungen hingegen sind komplett akzeptiert. Es ist vollkommen normal, sich bei Erkältungen, verstauchten Knöcheln oder Rückenschmerzen professionelle Hilfe zu suchen. Niemand hinterfragt einen Gips, alle wollen darauf unterschreiben. Bei psychischen Erkrankungen sieht das ganz anders aus: ungewollte, unempathische Fragen oder Bemerkungen wie “Ach, aber dir gehts doch gut. Sei nicht so undankbar”, oder “steh halt einfach eher auf und geh zum Sport” sind Gang und Gebe. Vermeintliche Ursachenfaktoren: falsche Ernährung, fehlende Vitamine, zu wenig Sport und mein absoluter Favorit bei Kindern und Jugendlichen: das Handy. Während all diese Dinge zur Entstehung einer psychischen Erkrankung beitragen können, so gibt es aber nicht DEN EINZIGEN FAKTOR, auf den alles zurückzuführen ist. Es ist eher wie beim Schach: am Anfang geht der Bauer verloren, irgendwann die Pferde, dann der Turm, die Dame und zack: Schachmatt. Aber wie auch bei einem Schachspiel ist der Weg dahin nicht immer gleich und verallgemeinerbar, deshalb sind auch die Lösungen nicht trivial und einfach.
“Good Vibes Only” ist das Motto dieser Zeit. Es blinkt mir täglich entgegen und ist so toxisch, dass ich mich übergeben möchte. Es trägt dazu bei, dass Menschen sich noch schlechter fühlen. Sie fühlen sich schlecht, weil sie sich schlecht fühlen. Meta-schlecht quasi. Das Empfinden einer ständigen Glückseligkeit ist jedoch utopisch. In einer Gesellschaft, die das ständige Glücklichsein mit permanenten Urlaubsgefühlen als die Normalität anpreist und im Gegenzug den Menschen durch Leistung definiert, ist es wirklich nicht verwunderlich, dass Menschen nicht über ihre Gefühle sprechen wollen, sie verdrängen, sich vor ihnen verschließen und sich selbst belügen. Die Frage nach dem Befinden wird automatisch mit “gut” beantwortet und im schlimmsten aller Fälle mit “passt schon”. Es wird selten nachgefragt und wenn, dann bestehen Antworten aus Ausreden wie “Ach, der ganz normale Wahnsinn” oder “Stress auf der Arbeit”. Die Blicke oder allein die Angst vor den Blicken und Reaktionen der Mitmenschen reichen aus, um die Abwesenheit des Wohlbefindens mit sich selbst auszumachen. Niemand möchte als “verrückt” abgestempelt werden. Heute benutzt man Worte wie “Klapse” oder “Irrenhaus” zwar nicht mehr so oft, jedenfalls nicht in meiner Generation, aber die Vorurteile über psychische Erkrankungen sind tief verwurzelt. Die Aufklärung und Edukation erfolgt nur spärlich und qualitativ auf einem Niveau, das der Moderne nicht angemessen ist. Auch die mediale Auseinandersetzung mit dem Themenbereich ist mehr als dürftig. Reportagen sind einseitig. In den Nachrichten sind nur die schlimmsten aller Ausprägungen psychischer Erkrankungen zu erleben. Psychische Erkrankungen werden über einen Kamm geschert, verallgemeinert und nicht differenziert genug betrachtet. Menschen werden in Schubladen gesteckt, in die sie nicht passen. Kein Wunder also, dass die Scham so groß ist.
Allerdings erstreckt sich unser Gefühlsspektrum nicht ausschließlich in das Positive, sondern eben auch in das Negative. Wenn man sich die Basisemotionen nach Ekman anschaut, dann überwiegen sie sogar. Von den sechs Grundpfeilern unserer Gefühlswelt (jedenfalls nach Ekman) befinden sich zwei auf dem positiven Spektrum: Freude und Überraschung, wobei die Überraschung auch nicht immer gut sein muss. Die anderen – Angst, Trauer, Wut und Ekel, sind in unserer heutigen Gesellschaft negativ konnotiert. Dabei kommt den Gefühlen eine große Bedeutung zu: sie sind Indikatoren für das Überleben. Während wir heute vielleicht nicht mehr vor Säbelzahntigern wegrennen müssen, so jagen uns andere Dinge schreckliche Angst ein. Die Zukunft ist es zum Beispiel bei mir. Mein Studium neigt sich dem Ende entgegen und ich weiß absolut nicht, in welche Richtung ich will – weder geografisch noch fachlich. Die Welt steht mir mehr oder weniger offen, es gibt zu viel Auswahl und gleichzeitig sehe ich am Ende des Studiumtunnels die Arbeitswelt ihre Zähne blecken. Ich bin sicher, Frau Krause geht es ähnlich. Wie gern würde ich ihr sagen, dass ich sie verstehe. Ich kann ihre Gefühle und Gedanken nachvollziehen. Gerade jetzt im Winter. Lange Nächte, kurze Tage. Die Farbe des Himmels wechselt die Grautöne, die Lage des Wetters und meiner Stimmung wechselt zwischen bewölkt, windig, Schneeregen und Schnee.
“Frau Krause, Sie sind nicht allein auf der Welt mit ihren Problemen”, als könnte meine Betreuerin meine Gedanken lesen, “es geht vielen Menschen ähnlich. Ganz viele Menschen haben mit ähnlichen Symptomen zu kämpfen. Das Gute ist aber, dass wir Ihnen helfen können. Sie sind die ersten Schritte gegangen. Gemeinsam schaffen wir das”.
Sie sieht uns in einer Mischung aus Unglauben, Trauer und Verlorenheit an. Gedankenschwere, Gedankenkreisen, Gedankenspiralen schwingen in ihren Blicken mit. Sie bleibt still, schnieft kurz und nickt dann kaum merklich während Schneeflocken beginnen zu fallen. “Ich hasse Schnee und Kälte”, murmelt sie vor sich hin und die drei Frauen im Raum wissen, dass damit nicht nur das Wetter gemeint ist.
Text: Ilka Reichelt
Bild: Francesco Ungaro
Anmerkungen:
Die Charaktere und Dialoge sind fiktiv. Sie sind lediglich an eigene Erfahrungen angelehnt.
Sollte es Dir momentan nicht gut gehen und du Hilfe benötigen, so kannst Du dich zunächst an wichtige Notfalltelefone wenden oder bei der Telefonseelsorge melden.
Wie es weiter geht
Altrosa.
*****Triggerwarnung: Sexueller Übergriff*****
Da steht ein Sack am anderen Ende des Flures, dessen transparente Hülle altrosafarbene Bettwäsche preisgibt. An sich ist er nicht groß, so groß wie ein normaler Müllbeutel eben groß ist.
An sich ist er nichts Besonderes, eine durchsichtige Tüte, gefüllt mit Stoff, Nähten und Reißverschlüssen.
An sich ist das alles nicht wirklich weltverändernd, nicht für Außenstehende jedenfalls.
Sie steht am anderen Ende des Flurs und starrt den Beutel mit einer Mischung aus Unglauben, Verachtung und Stolz an. Die ganze Situation scheint ihr irgendwie surreal und absurd.
Sie fühlt sich nicht wie sie selbst, nicht wie die Protagonistin ihres eigenen Lebens, sondern eher wie eine Zuschauerin.
Sie fühlt sich nicht als würde sie mit ihren eigenen Augen sehen, sondern als würde sie dem ganzen Spektakel eher zusehen.
Sie fragt sich, was andere Menschen jetzt wohl denken würden.
Sie fragt sich, ob andere Menschen auch so fühlen würden.
Sie fragt sich, ob andere Menschen auch dasselbe tun würden.
Sie fragt sich, ob sie nicht vielleicht doch überreagiert.
Es ist mehr als ein halbes Jahr, mehr als 6 Monate, mehr als 25 Wochen, mehr als 175 Tage her. Aber hier zählt ja niemand mit. Obwohl der Zeitraum so erschreckend lang klingt, so als dürfte sie deshalb keine emotionalen Reaktionen mehr zeigen, so erscheint er doch auch irgendwie extrem kurz. Jedenfalls in ihrer Erinnerung. Immer dann, wenn das Geschehene hochkommt und vor ihren Augen abläuft wie ein schlechter Film. Sie erinnert sich an den Klang der Stimme, an den Geruch des Raumes, an das Gefühl der Hände, die nicht ihre eigenen waren. Sie erinnert sich an Worte, Sätze, Gesichtsausdrücke, an Blicke und an die Farbe der Bettwäsche – altrosa.
Altrosa ist jetzt die Farbe, die sie mit Kontrollverlust und fehlender Zustimmung verbindet.
Die Erinnerungen kommen und gehen.
Manchmal einfach so, manchmal bei bestimmter Musik, manchmal an bestimmten Orten.
Immer bei der sich jetzt im Müllsack befindlichen Bettwäsche.
Unabhängig von der Anzahl der Kochwäschen, der guten Worte mit sich selbst, unabhängig von der im Nachhinein mehr oder weniger erzwungenen Entschuldigung, altrosa musste aus dem Arsenal an Habseligkeiten verschwinden.
Die Mülltüte am Ende des Flures starrt mit scheinbar 1000 Augen zurück. Sie verzieht keine Miene. Sie sagt nichts. Ihr nicht vorhandener Gesichtsausdruck spricht für sich. Sie spricht für sich.
Aber wofür eigentlich?
Für das Vergessen? Eher nicht.
Für einen Neuanfang?
Für Besserung?
Für Stärke?
Für den Rückkampf der Kontrolle?
Für Persönlichkeitswachstum?
Ja wofür sprechen Dinge eigentlich, wenn sie eingepackt in Plastik sind, am Ende des Flures stehen und hoffen, dass ihre permanente Abwesenheit Erleichterung verspricht?
Sie steht am Ende des Flures, starrt den Beutel mit altrosa Füllung mit einer Mischung aus Unglauben, Verachtung und Stolz an und hofft, dass die Erinnerungen langsam, aber sicher zumindest aus dem unmittelbaren Alltag schwinden.
Sie hofft, dass die Filme weniger werden.
Sie hofft, dass die Zweifel an ihr selbst weniger werden.
Sie hofft und sie hofft und sie hofft, dass es vorbeigeht.
Irgendwann.
Text & Bild: Ilka Reichelt
THE ELLA & SKUPPIN– was bewegt die jungen Musiker aus Chemnitz?
Beim Konzert von THE ELLA am Chemnitzer CSD im August sind Küsse, Umarmungen, bunte Fahnen, Make-Up-Glitzer und ein roter Rock auf der Bühne so natürlich und authentisch ineinander übergegangen, anders als man nach Boy-Band-Standard gewohnt ist.
Continue reading