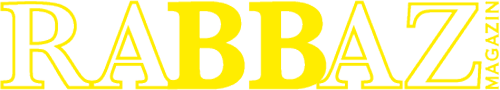500 € – einfach so vom Staat geschenkt: dieser Utopie kommen Einige seit dem 16. Juni ein Stückchen näher. Seit diesem Tag ist es möglich, online einen Antrag auf eine „Überbrückungshilfe“ zu stellen. Adressiert werden Studierende, die durch die Corona-Pandemie beispielsweise ihren Job verloren und sich deshalb finanziell „in akuter Notlage“ befinden. Klingt erstmal super – unumstritten ist die ganze Sache jedoch nicht.
Seit heute Mittag, 12 Uhr ist die langersehnte, staatliche Finanzierungshilfe für das Studium endlich da. Und zwar unabhängig vom elterlichen Einkommen und ohne Rückzahlung – zumindest für die Monate Juni, Juli und August. Auf überbrückungshilfe-studierende.de kann der Antrag online eingereicht werden. 100 Millionen Euro stehen hierfür insgesamt zur Verfügung. Die tatsächliche Auszahlung wird „innerhalb der verfügbaren Mittel“ entschieden, was bedeutet: ob die Antragsteller*in das Geld ausbezahlt bekommt, ist nicht gewährleistet.
Alle Studierenden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland immatrikuliert und nicht beurlaubt sind, können von diesem Angebot Gebrauch machen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Jetzt kommt das große ABER: es muss eine Notlage nachgewiesen werden. Das bedeutet: ab mehr als 500 € auf dem Konto gibt es nichts mehr und von einem Antrag sollte dann auch abgesehen werden. Als Nachweis müssen Kontoauszüge bis zum Zeitpunkt der letzten normalen Einnahme (also bis Februar/März) eingereicht werden, dazu u.a. eine Erklärung für das Ausbleiben von Einnahmen.
Die Überbrückungshilfe wird dann laut dem Deutschen Studentenwerk (DSW) folgendermaßen berechnet:
| Kontostand | Überbrückungshilfe |
| weniger als 100,00 € | 500,00 € |
| zwischen 100,00 € und 199,99 €* | 400,00 € |
| zwischen 200,00 € und 299,99 € | 300,00 € |
| zwischen 300,00 € und 399,99 € | 200,00 € |
| zwischen 400,00 € und 499,99 € | 100,00 € |
*die Nachkommastellen wurden nachträglich eingefügt, beim DSW steht noch 199,00; 299,00 usw.
Die Anträge können erst ab dem 25. Juni bearbeitet werden, mit der ersten Auszahlung ist demnach frühestens Anfang Juli zu rechnen. Die Bewilligung gilt einmalig; jeden Monat muss bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats erneut eine Förderung beantragt werden. Die Zuschüsse sollen, wie ihr Name schon sagt, die Zeit überbrücken, bis die Studierenden wieder Zugriff auf ihre regulär gewohnte Einkommensquelle haben.
Finanzielle Not wegen Corona
Diese Maßnahme ist eine Reaktion der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) auf die scharfe Kritik seitens Studierendenverbänden und Politiker*innen. Ihr wird vorgeworfen, viel zu langsam und nicht hinreichend auf die Geldsorgen von Studierenden zu reagieren.
Wegen des Lockdowns fielen viele Nebenjobs, u.a. in der Gastronomie, weg, die für Studierende eine Existenzgrundlage darstellten; betroffene Eltern können wegen Kurzarbeit oder gar Kündigung ihre studierenden Kinder nicht mehr ausreichend finanziell unterstützen.
scharfe Kritik am KfW-Kredit
Seit Mai 2020 wird, nach einem Vorschlag Karliczeks, der KfW-Studienkredit als Corona-Hilfe für Studierende vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt. Bis März 2021 ist der Kredit zinsfrei. Seit dem 01.06. dürfen auch internationale Studierende den KfW-Studienkredit beantragen. Vorschläge der SPD oder der Grünen, das BAföG für Studierende zu öffnen, die bislang keine Leistungen beziehen konnten, wurden nicht gehört. Der Gewerkschafter Andreas Keller bezeichnete den KfW-Kredit gegenüber dem Spiegel als „im Ansatz völlig verfehlt“, der freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) hält den Kredit für „zu wenig, zu engeschränkt, zu starr und ungerecht“. Nach dem zinsfreien Jahr winken nämlich hohe Zinsen im Wert von bis zu 3.500 €, die besonders für Studierende aus einkommensschwachen Familien auch nach dem Studium kaum zu stemmen sind. Der DSW-Generalsekretär meint, Studierende, die ihren Job verloren haben, wären mit dem Kredit doppelt bestraft, da diese hinterher noch mehr arbeiten müssten, um den Kredit abzubezahlen.
„an Dreistigkeit nicht zu überbieten“
Kein Wunder also, dass laut Amanda Steinmaus, Vorstand des fzs, die Überbrückungshilfe „an Dreistigkeit nicht zu überbieten“ wäre. Sie würde den Studierenden in finanziellen Notsituationen nicht wirklich helfen – dafür sei der Topf zu klein, die Auszahlungen zu gering und die Anforderungen sowie der bürokratische Aufwand zu hoch. Die veranschlagten 100 Millionen Euro reichen hinten und vorne nicht, um finanzielle Engpässe bei geschätzt einer Million Studierenden auszugleichen. „Wenn 66.666 Studierende drei Monate lang 500 € erhalten, ist der Topf leer,“ gibt Jacob Bühler, ebenfalls Mitglied des fzs-Vorstands, in einer Pressemitteilung an.
Fraglich ist, wo die 900 Millionen Euro an Haushaltsmitteln hin sind, die letztes Jahr für BAföG zur Verfügung gestellt und nicht ausgegeben wurden. Eine Öffnung des BAföG mit diesen Mitteln wäre ein gerechterer und nachhaltigerer Ansatz gewesen, um krisengeschuldete Studienabbrüche zu vermeiden und Bildungsgerechtigkeit zu fördern.
Übrigens: für Studierende der TU Chemnitz gilt, dass die Förderhöchstdauer von BAföG trotz Nicht-Anrechnung des Sommersemesters 2020 gleich bleibt. Das bedeutet: dieses Semester zählt für das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau als „normales“ Semester; die Förderhöchstdauer verschiebt sich durch die Rückstufung nicht. Nur bei „unvermeidbare[n] pandemiebedingte[n] Ausbildungsunterbrechungen“ mit „schwerwiegende[m] Grund im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 1 BAföG“ kann eine Weiterförderung beantragt werden.
bei der Bildung wurde wieder einmal gespart
Diese Bilanz ist, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass anscheinend Mittel zur Verfügung stehen, schade. Deutschland hinkt beim Thema Bildungsgerechtigkeit ohnehin stark hinterher; die besagten staatlichen Maßnahmen, die während der Corona-Pandemie als Überbrückungshilfen angeboten werden, zeigen, wie sehr gerade bei der Bildung gespart und eher symbolisch gehandelt wird. Im Ernstfall sind die Krisenfonds leider wenig hilfreich und können bestehende Ungleichheiten sogar vertiefen. Die Überbrückungshilfe ist klar besser als nichts und kann im Zweifelsfall eine kleine Abhilfe schaffen. Jedoch sollte sich die Bildungspolitik nicht auf ihren kleinen Geldtöpfen ausruhen und auf Kredite verweisen, die in keinem Fall eine echte und gerechte Studienförderung ersetzen können.
Am 20.06. ruft die fzs übrigens gemeinsam mit Studierendenvertretungen aus ganz Deutschland zu einer Demonstration für eine Milliarde Studi-Hilfe auf.
Text und Bild: Julia Jesser