Aus der Vergangenheit lässt sich entnehmen, dass der Bezirk des heutigen Stadtviertels bereits diverse Zwecke erfüllt hat: Vom Weideland für Vieh über einen Schützenplatz bis hin zum belebten Brühl-Boulevard in den Achtzigern und dem folgenden Verfall des Viertels. Die Gentrifizierung, insbesondere des Brühl-Boulevards soll dem Stadtviertel neues Leben erwecken. Wie fortgeschritten ist dieser Prozess aktuell am Brühl? Uwe Dziuballa, der Geschäftsführer des jüdischen Restaurants Schalom ist seit 2005 sesshaft am Brühl. Von 2005 bis 2012 konnte er keine großen Veränderungsprozesse feststellen („keine Baustelle auf der Straße und keine Haussanierung im Umfeld“).
Am 25. April 2012 genehmigte der Stadtrat das Konzept „Städtebauliche Planungsstudie zur Entwicklung des Gebietes Brühl-Boulevard in Chemnitz“ vom Planungsbüro Albert Speer & Partner. Passend dazu erinnert sich Dziuballa im Zeitraum von 2012 bis Ende 2020 an einige „bauliche“ Veränderungen. Der Unternehmer berichtet von neun Baustellen und einer monatelangen Straßensperrung, sowie zwölf Häusersanierungen und der Restaurierung der Unibibliothek. Zudem hätten immer mehr Geschäfte geöffnet. Ein Pressesprecher der Stadt Chemnitz gibt an, die Wiederbelebung des Brühls würde seit Mitte der 90er Jahre „als Fördergebiet der Stadtneuerung“ mittels diverser Förderprogramme von Bund, Land oder der EU unterstützt werden. Das EU-finanzierte URBAN-Projekt, welches seit 1995 die Entwicklung am Brühl förderte richtete sich mehr auf das Gebäude im Gründerzeit-Stil im nördlichen Teil des Brühls. Bis etwa 2005 sei die Restaurierung von Häusern im Bereich des Brühl-Boulevards erschwert worden, durch die „schwierige Klärung“ der Ansprüche von Alteigentümern auf ihre Häuser. Daher sei erst 2011, mit dem Beschluss des Landes, eine Umsiedlung der zentralen Unibibliothek in die Innenstadt zu ermöglichen, der Gentrifizierungsprozess des Brühl-Boulevards konzentriert umgesetzt worden, so der Pressesprecher. Hierfür wurde die alte Aktienspinnerei „für einen symbolischen Euro [an den Freistaat] ‚verkauft‘ “. Am 1. Oktober 2020 wurde die Zentralbibliothek schließlich eröffnet. Wie steht es also um den Rest des Stadtviertels?
Um einen Einblick in die bisherigen Gentrifizierungsschritte am Brühl zu geben, sollten wir uns zunächst eine Frage stellen: Was bedeutet Gentrifizierung eigentlich?
Der Begriff Gentrifizierung wurde erstmals von der Soziologin Ruth Glass verwendet und beschreibt Umwandlungsprozesse in Stadtteilen, welche teils mit der fortschreitenden Globalisierung einhergehen. Mit der Veränderung des Charakters eines Stadtviertels zu einem moderneren Viertel soll somit eine Veränderung der Bevölkerung eintreten. Dadurch soll die Attraktivität des Viertels erhöht werden, besonders für einkommensstärkere Bevölkerungsschichten. Die Überlegungen basierten auf Glass‘ Beobachtungen eines Londoner Stadtteils, welcher sich in den 1960er stark veränderte. Wortwörtlich beschreibt das Wort „Gentrifizierung“ einen Prozess, bei welchen sich immer mehr Leute des niederen Adels (engl. gentry) auf Grund höherer Attraktivität in einem Gebiet ansiedeln. Dieser Imagewandel lässt sich in folgendem Prozess beschreiben: Im Ausgangszustand befindet sich ein Stadtviertel größtenteils im Leerstand. Es könnte als verlassenes Viertel beschrieben werden. Aus Neugier, Interesse und der preislich günstigen Lage werden im Folgenden Kreative/ Künstler:innen, sowie risikobereite Unternehmer:innen angelockt. Durch künstlerische Arbeiten und Projekte verwandelt sich das Viertel zum Szeneviertel und zieht somit die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Nach dem schematischen Ablauf entstehen dadurch sanierte oder neue Wohnungen, hohe Mieten und wohlhabendere Bewohner:innen. Auf der Kehrseite kann es durch die Gentrifizierung eines Stadtviertels zu einer Verdrängung einkommensschwacher Bevölkerung aus dem Viertel hin zu wohlhabenderen Bewohner:innen kommen.
So bemerkte Martin König, Jungunternehmer und Besitzer des regionalen Bekleidungsgeschäftes „Karlskopf“ beispielweise die entstehenden hohen Mieten. Sie lägen mittlerweile teils bei 10€ pro Quadratmeter. Dies führt „verständlicherweise“ dazu, dass viele Anwohner des Brühls teils ihre Nachtruhe eingehalten sehen wollen. So sieht König die Akzeptanz der Anwohner:innen als eine Hürde für die urbane Entwicklung des Stadtgebietes Brühl an.
„Im Sommer standen bei meinen Veranstaltungen genau [um] 23 Uhr die Polizei vor seinem Laden, weil bereits gegen 22 Uhr die ersten Anwohner[:innen] eine Beschwerde hinterlassen hätten […].“, erinnert sich der Jungunternehmer.
Die Stadt Chemnitz berichtet von einer Vielfalt an Wohnraum mit verschiedener Ausstattung und Preislage am Brühl für breite Zielgruppen und nach wie vor günstiger als in anderen Großstädten Sachsens, beispielsweise in Leipzig. Neben der Unger Gruppe hätten die Wohnungsgesellschaft GGG und nachwirkend einige Investoren die Gebäude am Brühl breitflächig saniert.
Uwe Dziuballa sammelte an seinem vorherigen Standort des jüdischen Restaurants „Schalom“ negative Erfahrungen (2000-2011). Daher suchte er nach einem neuen Standort. Seine Entscheidung fiel auf das Brühl-Viertel, da er dem Stadtteil, welcher “gefühlt komplett die ‚Wende‘ Neuorientierung der Stadt verschlafen hatte, das mit Abstand größte Entwicklungspotenzial zutraute“. Darauf angesprochen vermerkt Dziuballa, dass seine Restaurantöffnung (das Schalom) an dem Brühl-Boulevard wohl eine merkliche Entwicklung auf die Veränderungen hatte – sprich eine Vorreiterrolle. So hätten sich einige “Gäste des Schaloms nach dem zweiten oder dritten Restaurantbesuch für den Brühl interessiert und später ihre Wohnung hier gesucht“.
Die Plätze im Schalom seien seit 2013 so beliebt, so Dizuballa, dass sie schon im weiten Voraus ausgebucht sind. So müssten im Jahresdurchschnitt zwischen 24 und 183 Absagen an spontane Restaurantbesucher:innen ausgeteilt werden. Aus unternehmerischer Sicht hat Dziuballa daher seit 2013 keine große Entwicklung bezüglich seines Restaurants festgestellt, er hofft und wünscht sich jedoch für das Stadtgebiet “ substanzielle Entwicklungen“, auch wenn es für ihn aus wirtschaftlicher Sicht wohl kaum eine Veränderung ergeben würde.
Heute, neun Jahre nach dem Beschluss des städtebaulichen Planungskonzept, blickt der Brühl-Boulevard auf einige Veränderungen. Ein Pressesprecher der Stadt Chemnitz berichtet, von dem einstigen Leerstand des Stadtviertels (im Jahr 2012 schätzungsweise 80%) sei aktuell kaum noch zu bemerken. Das Quartier Brühl sei als „innerstädtischer Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten sehr nachgefragt“ und sei nicht nur für Chemnitzer:innen ein attraktives Stadtviertel. Im Sommer 2020 wurden die Bewohner:innen des Brühls gefragt, welche Eigenschaften sie an dem Stadtviertel besonders schätzen. Dabei gaben 26,8 % die Innenstadtnähe, 17,3 % den Kiezcharakter und 13,4 % die kulturellen Angebote an. Ein verhältnismäßig geringer Anteil von 4,9 % der Befragten schätzen das lokale Shopping-Angebot. Verschiedene Start-ups und gastronomische Unternehmen haben sich angesiedelt. Unternehmer:innen mit der Idee, einfach mal etwas anderes auszuprobieren, Mut aufzubringen. Der Jungunternehmer Martin König ist überzeugt von der Lage des Brühl-Boulevards und beschreibt seine Gründe für die Standortwahl wie folgt „Geiler Laden, geile Terrasse, günstige Ladenmiete, super nah zu meiner Wohnung, das Flair des Brühls passt perfekt zu meinen Shirts, die naheliegende Unibib.“ Er sieht jedoch noch Verbesserungsbedarf in dem Zusammenhalt der Brühlgemeinschaft und hofft auf eine höhere Besucherfrequenz auf dem Brühl-Boulevard.
Dizuballa sieht in dem Brühl-Viertel „einen paradoxen Scharm aus Großstadt, Ruhe, Aufbruch, solide[n] Entwicklung[en]“. Er erhofft sich „Experiment[e] mit neuen (lauten) Veranstaltungen“. Unternehmerische Vorteile des Brühls wären nach Dziuballa “nicht nur in der Nähe zur Innenstadt, welche durch das Bauwerk hinter dem Karl-Marx-Monument als Grenze eine Art Barriere bildet, (…), sondern [auch] die Möglichkeit der Chemnitzer-Macher-Entwicklung.


Wie sieht es wohl in der Zukunft für das Brühlviertel aus? Welche Pläne haben die Beteiligten? Dieser Thematik werden wir uns in dem dritten und finalen Artikel der Brühlreihe widmen. Ihr könnt diesen Artikel in sechs Wochen auf unserer Website lesen.
Text und Fotografie: Lisa Heinemann und Anna Thomas
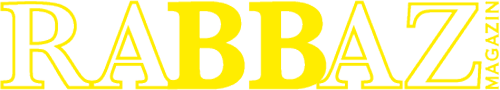




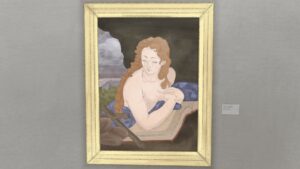
No comment yet, add your voice below!