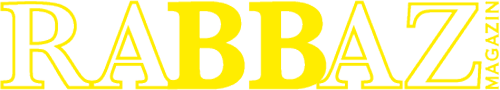Klassismus. Nicht mal Word kennt diesen Begriff. Ich bin das erste Kind aus meiner Familie, das das Abitur geschafft hat und dann auch ein Studium erfolgreich abschloss. Es war eine lange Reise. Inzwischen bin ich aber in der Welt der Akademiker:innen angekommen. In einer Welt, die meinen Hintergrund aber nur theoretisch zu begrüßen scheint, praktisch soll ich ihn mir nicht anmerken lassen. Wenn mir das gelingt, bin ich aber unbedingt gewollt, denn die Chancengleichheit in Deutschland ist nach den OCED Studien von 2018 immer noch ausbaubedürftig und der Begriff Bildungsgerechtigkeit liegt in aller Munde. Klassismus ist laut Andreas Kemper und anderer Soziolog:innen ein riesiges Problem an deutschen Universitäten. Zugleich aber auch blinder Fleck.
Ich wurde in Berlin geboren, mitten in eine kunterbunte Patchworkfamilie. Wir waren viele Kinder, es war chaotisch, voll und lärmend. Mal zog ein Kind aus, ein neues tauchte auf, eins verschwand. Geld war meistens knapp. Manchmal kamen die gelben Briefe. Briefe, in denen sie uns mitteilten, dass sie kommen wollten, um uns alles wegzunehmen. Meine Mutter war seit der Wende arbeitslos. Mein Vater arbeitete damals im Krankenhaus in der Küche. Das war reine Plackerei, undankbar und hart und er wurde gemobbt. Aber er arbeitete immer gewissenhaft und wir waren stolz auf ihn. Er brachte uns oft mit, was auf den Essenstabletts der Patient:innen noch so übriggeblieben war. Joghurts, eingepackte Küchlein, ein paar Aufstriche. Es war das Highlight jedes Tages, beim Schlüsselklappern zur Tür zu stürmen und ihn aufgeregt zu fragen, was er heute für uns aus der Küche geschmuggelt hatte. Verboten war das natürlich. Damals erschien uns das sinnlos. Ein weiteres Diktat der Versicherungen, die sich nicht um die Kindermünder armer Arbeiter:innen scherten. Heute weiß ich um die Keime und Bakterien und mit welcher Abscheu das Pflegepersonal eben jenes übriggebliebene Essen behandelt, das wir strahlend an uns rissen. Ganz arm waren wir aber nicht. Zum Beispiel hatten wir auch öfter Schokoladencreme fürs Brot und wenn Geld zur Verfügung stand, wurde es in uns investiert. So erhielt ich einige Jahre Geigenunterricht. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, wurde ich oft nicht richtig satt. Und das Gefühl, so viel essen zu können, wie ich wollte, lernte ich erst in meinen Zwanzigern richtig kennen. Während mein Vater die Schule noch vor seinem ersten Schulabschluss abbrach und bis heute weder richtig schreiben noch lesen kann, weiß meine Mutter unglaublich viel. Aber sie war zuhause. Depression. Wir kannten das Wort Depression aber nicht. Wir nannten es „keine Lust zu arbeiten“ und waren manches Mal sauer auf sie. Wir Kinder beschäftigten uns mit uns selbst. Wir waren viel draußen und frei. Eigentlich war es egal, was wir machten, solange die Noten stimmten. Den ersten Polizeikontakt hatte ich mit sechs. Es hätte mit mir auch in eine andere Richtung gehen können. Dessen bin ich mir bewusst. Die Korrelate der Armut. Manche schenkten mir Abenteuerlust und die Möglichkeit, eigene Perspektiven zu entwickeln, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen und ohne großen familiären Druck. Andere wiederum waren nur schwer verdaulich und hinterließen Spuren.
Nun wird von einem jede Menge verlangt, wenn man das Milieu Richtung Mitte wechseln will. Es gibt so viel Neues, an das man sich erst gewöhnen muss. Da wäre zunächst das Offensichtliche. Die Orte der Gesellschaft, die Geld als wesentliches Medium der Zugehörigkeit verlangen. Wie Friseur:innenbesuche, Auto fahren, Sportvereine besuchen, Urlaub machen oder auch nur der regelmäßige Stopp beim Schnellimbiss. All der Luxus, aus dem eine Vielzahl von Menschen ausgeschlossen sind. Sich daran zu gewöhnen war schön, ja, es hatte etwas Befreiendes, manchmal aber auch Irritierendes. Zum Beispiel drehte sich das Tischgespräch bei unseren ersten familiären Restaurantbesuch ausschließlich darum, dass man unbedingt den Aschenbecher oder irgendetwas anderes stehlen müsste. 70 Euro für das Essen von fünf Personen zu verlangen empfanden wir als dreist. Neben diesen offensichtlichen Anforderungen gab es auch die Aufgabe, subtile Merkmale wie die Mimik und die Gestik – all das, was Bourdieu als den Habitus der Klasse beschreiben würde, anzupassen. Denn Umgangsweisen und die Art und Weise wie man sich nach außen hin gibt unterscheidet das Mittelklassenumfeld stark von dem, was ich gelernt habe. Diesen Bereich erlebe ich als veränderungsresistenter. Statt laut zu lachen, lacht man leise, ja fast anmutig. Nur nicht zu herzhaft. Man muss gebildet wirken und klug und diszipliniert und man muss sich gut artikulieren. Kritik äußert man höflich. Keine Wut und nicht streiten. Man soll leise sein, man… Das sind nur einige Beispiele für grundlegende Umgangsformen, die ich anders gelernt habe. Ich erlebe es wie eine andere Lebensrealität, eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires, die sich bis ins Kleinste definiert. Um die Metamorphose des klassenreisenden Individuums schließlich erfolgreich abzuschließen, muss auch der Geist mitkommen. Das Selbst muss angepasst, eine neue Identität entwickelt und in die Alte integriert werden. Glaubenssätze wie „Akademiker:in sein übersteigt meine Möglichkeiten“ oder „Dafür bin ich nicht klug genug“ müssen überwunden werden. Es ist ein Austritt aus dem kollektiven Denken der Familie.
Seit dem Eintritt in die Uni sind die Unterschiede zum Ausgangspunkt meines Weges maximal. Trotzdem habe ich mich selten schamerfüllter für meine Vergangenheit gefühlt. Ein Blick auf mich selbst, der von oben herab, mit Arroganz und Mitleid, auf meinen Background starrt und mit dem Kopf schüttelt. So als wäre das Milieu, in dem ich groß geworden bin, unterentwickelt. So als würde mir bis heute etwas fehlen. Ich schäme mich für meinen Fernseher an der Wand und achte darauf, dass er in den Onlinemeetings der Uni nicht zu sehen ist. In anderen Kreisen ist mir das egal. Selbst in Kreisen, wo noch mehr verdient wird, in dem die Leute noch „weiter oben“ sind. Warum im Unikontext nicht? Das hat viel mit mir zu tun, mit den Glaubenssätzen, die ich als Kind vermittelt bekommen habe. Aber auch mit dem, was ich im Unikontext erlebe. Ich habe kaum Kommiliton:innen in meinen Einskomma- NC Studiengang getroffen, von denen ich weiß, dass sie Ähnliches erlebt haben. Eigentlich nur Eine. Eine wütende junge Frau, die kein Bock auf „akademisches Gehabe“ hatte und das auch alle wissen ließ. Statistisch muss es sie doch aber geben. Immerhin sind nach der 21. Sozialerhebung ganze 48% der Studierenden nicht aus akademischen Verhältnissen. 21 % der Kinder aus Arbeiter:innenfamilien studieren. Aus den Hartz-IV-Familien sind es aber nur noch 10%. Zur letzteren Gruppe fühle ich mich zugehörig. 12 % bekommen Bafög. Nun aber, wo sind die anderen? Verstecken sie sich so gut sie können? Oder was ist da los? Was erleben sie so? Nicht ein einziges Mal in meinem zig Jahren Uniausbildung hatte ich dazu auch nur einen einzigen Austausch und es ist nicht so, dass das keine Rolle spielt. Es ist einfach so verdeckt und schambehaftet, dass man sich dazu nicht outet.
Manchmal ecke ich an, wenn etwas unpassend war. Dann gibt es genervte Blicke oder hochgezogene Augenbrauen und Abwehrhaltung, von Professor:innen und Studierenden. Kenne ich nur zu gut inzwischen und manchmal werde ich dann auch wütend. Es ist Seminar. Ich lache, fand etwas witzig. Abschätzige Blicke von Mitstudent:innen. Klar, gegenseitige Erziehung und Anpassung, um dem sozialen Raum Struktur zu geben. War wohl zu lebendig für den Kontext. Aha. Ich frage einen Professor energisch und aufgeregt nach einer offenen studentischen Mitarbeiter:innenstelle, die mich wirklich interessiert. Er schaut verärgert und irritiert, murmelt etwas von „Chancengleichheit“ und „E-Mail“ und schlägt mir die Tür vor der Nase zu. Den Job kriege ich sicherlich nicht. Ein andernmal bemerke ich, wie meine Gedanken nicht aufgegriffen werden. Ich weiß aber, dass sie klug sind. Ich merke, es liegt an der Ausdrucksweise. Ich bilde mir das nicht ein. Diese und ähnliche Momente gab es im Präsenzstudium ständig. Wenn über Menschen mit wenig Geld gesprochen wird, schwingt da oft so ein Mitleid mit. So ein „Ach, die Armen“. Irgendwie von oben herab. Das macht mich echt wütend. Es sind oft die systemischen Umstände, die zur Verarmung einer Vielzahl von Menschen beitragen. Jobs, die nicht gerecht bezahlt werden. Wir brauchen kein Mitleid. Empörung auf Augenhöhe wäre hilfreicher und respektvoller.
Ich nehme es den Einzelnen auch nicht übel. Ich trage auch jede Menge Vorurteile in mir selbst herum. Klassistische, sexistische und rassistische, und sicherlich jede Menge mehr. Trotzdem bin ich genervt und das ist gut so. Denn mein Habitus fühlt sich für mich hier ungewollt an. Ich fühle mich diskriminiert. Ich habe keine Lust mehr, meine Energie darauf zu verwenden, mich passgerecht in die Schablone von feinen Ärt:innentöchtern zu zwängen. Ich bin stolz auf meine Herkunft, die für mich auch eine andere Kultur bedeutet. Die Welt der Akademiker:innen, wie ich sie kennengelernt habe, ist schön, aber ein Mix aus beiden trifft doch eher meinen Geschmack. Ich durfte die Gesellschaft von mehr Seiten kennenlernen, als jemand, der „nur“ in Mamas Fußstapfen treten musste. Ich habe Flexibilität und echte Toleranz gelernt und kann mich problemlos mit Mitgliedern verschiedener Schichten auf echter Augenhöhe verbinden. Das sind nur einige der Qualitäten, auf die ich und andere Arbeiter:innen- und Hartz-IV-Kinder stolz sein können. Es ist Zeit, dass wir erhobenen Hauptes und mit aneckenden Gewohnheiten die Machtstrukturen, die durch die unsichtbaren Gesetze Bourdieus beschrieben werden können, zum Wanken bringen.
Ich wünsche mir von der Studierendengemeinschaft, dass die Existenz von Klassismus, also der Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit, mehr in das Bewusstsein rückt und seinen angemessenen Platz zwischen den anderen -ismen einnimmt. Ich hoffe, dass unsere Generation dazu beitragen wird, dass der Begriff Klassismus aus dem Wortschatz von Word nicht mehr wegzudenken ist.
Autorin: anonym
Grafik: Theresa @klein.kunst.kanal