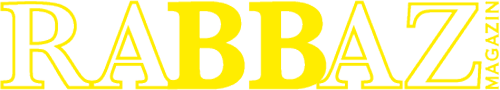Was ist falsch an diesem System?
In der letzten Aprilwoche wurden traurige Neuigkeiten bekannt: In Potsdam Babelsberg wurden vier Menschen in einer Behinderteneinrichtung getötet und eine weitere Person schwer verletzt. Das passierte an dem Ort, den behinderte Menschen ihr Zuhause nennen. Dort, wo sie schlafen, essen und arbeiten, ihren Lebensmittelpunkt haben, der für sie geschaffen wurde. Ermordet wurden sie von einer Mitarbeiterin, die ebenso der Einrichtung angehörte. Inzwischen wurde diese in einer Psychiatrie eingewiesen.
Der Aufschrei darüber, wie so etwas passieren konnte, war nie wirklich laut und ging genauso wenig viral. Dabei sind seit Jahren die Missstände in den Einrichtungen bekannt, unter anderem, dass Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind. Das Themenfeld der Diskriminierung von behinderten Menschen ist groß, was aber nicht heißt, deswegen nicht anzufangen sich mit der Thematik auseinander zu setzen.
Dieser Text konzentriert sich auf die Behindertenwerkstätten, die Wohnheime und der systematischen Ungleichbehandlung hinsichtlich der Entlohnung. Amelie, die in einer stationären Wohneinrichtung lebt und in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, spricht in diesem Text von ihren Erfahrungen, zu denen vor allem die sozialen Momente zählen und weniger das System und die Strukturen an sich. Wie einige weitere Beschäftigte in der Behindertenwerkstatt kann sie das aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten nicht durchblicken. Aber erst einmal zurück zum Anfang.
Routinierter Alltag als Voraussetzung
Amelie ist geistig behindert, das heißt, dass sie in ihren kognitiven, motorischen und emotionalen Fähigkeiten weniger weit entwickelt ist als andere Menschen in ihrem Alter. Nach ICD-10 wird von einer „Intelligenzminderung“ gesprochen, die bei einem IQ unter 70 anfängt. Bis Amelie 22 Jahre alt war, wohnte Amelie bei ihren Eltern. Jeden Tag benötigte sie Unterstützung und Anleitungen bei alltäglichen Dingen, wofür Routinen sehr hilfreich waren und auch ihr weiteres Leben lang wird sie auf diese Hilfe angewiesen sein.
Ich verabrede mich mit Amelie zu einem Onlineinterview. Ihre Mutter hat sie an dem Wochenende zu Besuch und erzählt ihr nicht direkt davon, sonst wäre die Aufregung und Freude zu groß. Da sitze ich also mit Amelie und mir wird entgegengegrinst und ihre Laune steckt sofort an. Sie zeigt mir ihre neue, silberne Herzchenkette und nebenbei tönt Musik aus einer schwarzen Musikbox. Musik macht Amelie glücklich, genauso wie nähen, Mandalas malen und Bollywoodfilme. Von einem der Schauspieler hat sie ein Poster über ihrem Bett hängen. Seit längerem bewohnt Amelie ihr eigenes Zimmer in der Wohngemeinschaft, die sieben weitere junge Erwachsene bilden. Weiterhin hat ihr Alltag hier Struktur. Jeder Tag beginnt mit einem gemeinschaftlichen Frühstück und anschließend geht es zur Arbeit in die Behindertenwerkstatt. In ihrem Arbeitsbereich, der Wäscherei, verbringt Amelie in der Regel sieben Stunden am Tag, Mittagspause mit eingerechnet. Wäre da nicht Corona. Bis Mitte Juni ist die Arbeit für die Bewohner:innen des Wohnheims allerdings erst einmal ausgesetzt, aufgrund von Coronavorsichtsmaßnahmen. Sind alle Bewohner:innen geimpft, ist eine Arbeitsaufnahme geplant. Amelie redet von „Scheiß Corona“, weil sie das Arbeiten vermisst und die gemeinsamen Mittagszeiten mit den Betreuer:innen und vor allem ihren Freund:innen, die sie außerhalb der Arbeit gerade nicht sieht, weil diese nicht mit ihr zusammen wohnen.
Werkstätten für behinderte Menschen- ein prekäres System?
Amelie verdient im Jahr 2000 Euro, wobei sich bei ihr die Verdienstabrechnung aus dem Arbeitförderungsgeld, einem Grundbetrag und einem Steigerungsbetrag sowie Arbeits- und Urlaubsgeld zusammensetzt. Vor einiger Zeit schon hat sich ein Protest gebildet, der sich für die bessere Bezahlungen in Behindertenwerkstätten einsetzt.
In Sachsen, dem Bundesland mit den niedrigsten Löhnen, kam es von 2017 bis 2019 zu Stundenlöhnen von weniger als 50 Cent. Dabei ist bekannt, dass die Werkstätten mit ihren 310.000 Beschäftigten jährlich einen Umsatz von 8 Milliarden Euro machen. Von dem Staat werden sie zusätzlich noch vollfinanziert und sie sind Teil der Industrie, in der gerne auf die guten Angebote mit entsprechenden Qualitätsstandards zurückgegriffen wird. Große Unternehmen lassen in den Werkstätten produzieren, sind damit nachhaltig und erfüllen damit den Schwerbehindertenausgleich schon zu 50 Prozent. Es ist sonst gesetzlich vorgeschrieben, dass bei einem Betrieb mit 20 Mitarbeiter:innen fünf Prozent der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Arbeitskräften besetzt werden müssen. Neben der Beschäftigung in Werkstätten und Inklusion am Arbeitsplatz gibt es sonst die Möglichkeit, den Ausgleich finanziell zu leisten: Je nach Größe des Unternehmens sind es 125 bis 320 Euro im Monat pro unbesetzten Arbeitsplatz. Aus den Werkstätten werden nur 0,02 Prozent der Mitarbeiter:innen an den Arbeitsmarkt vermittelt.
Dabei haben sich die Werkstätten laut Sozialgesetzbuch Paragraph 219 die Integration der Werkstattbeschäftigten in den Arbeitsmarkt zur Aufgabe gemacht:
„Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben (…) und zur Eingliederung in das Arbeitsleben […]. Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.“
Die 30 Prozent der Werkstattbeschäftigten, die in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis stehen, bei allen anderen werden noch Sozialleistungen miteinberechnet, kommen aus dem System nicht heraus und erhalten trotzdem keinen gesetzlichen Mindestlohn von 9,50 €. Es ist ein Teufelskreis, in dem Werkstätten für behinderte Menschen Milliarden an Umsatz machen, Beschäftigten die Chance auf eine ordentliche Bezahlung verwehren und eine Integration durch den Schwerbehindertenausgleich durch Aufträge an die Werkstätten oder eben den viel zu niedrigen monetären Ausgleich noch verstärken. Es ist gar unmöglich, in den normalen Arbeitsmarkt zu wechseln und es muss sich dringend etwas ändern und zwar am ganzen System.
So kritisiert auch Ulla Schmidt, frühere Vizepräsidentin des deutschen Bundestages, ehemalige Bundesgesundheitsministerin und aktuelle Vorsitzende der Lebenshilfe zu der monatlichen Entlohnung in WfbM:
„Das ist nicht mehr als ein Taschengeld. Auch wenn Menschen mit Beeinträchtigung zusätzlich Sozialleistungen bekommen, empfinden sie ihren Lohn als viel zu niedrig und höchst ungerecht. Sie haben einen besseren Lohn verdient. Schließlich gehen die meisten von ihnen wie alle anderen fünf Tage die Woche zur Arbeit.“
Was sich ändern muss
Die mangelnde Bereitschaft zur Inklusion fängt in den Kindergärten und auf den Schulen an. Die Chancen auf eine selbstbestimmte Zukunft sind mit dem Abschluss von einer Förderschule gering. Denn sobald die Förderschule geschafft ist, geht es mit einem Job von einer Behindertenwerkstatt weiter. Gesetze wie die des Schwerbehindertenausgleiches diskriminieren systematisch weiter. Wenn es solche Gesetze gibt, wer ist dann überhaupt bereit, Menschen mit Behinderung zu inkludieren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen?
Eine Behinderung verlangt einen unermesslichen Zeitaufwand, denn die bürokratischen Verfahren sind oft intransparent und sehr komplex. So verbringt Amelies Mutter, die gleichzeitig auch ihre gesetzliche Betreuerin ist, durchschnittlich 4-5 Stunden die Woche mit Behördenkram. Oft fehlt selbst Ärzt:innen, Pflegegradbegutachter:innen und auch Lehrkräften einfach das Wissen. Aber wie können wir alle dazulernen, wenn Menschen mit Behinderung immer noch zu wenig in unserem Alltag präsent und inkludiert sind?
Ein paar von den Menschen, die zum Thema Inklusion in den sozialen Medien aufklären:
@ninalagrande
@lauragehlhaar
@edwin.greve
Hier kannst du eine Petition für bessere Bezahlung in Behindertenwerkstätten unterschreiben.
Amelie hofft so wie wir alle, dass Corona wieder vorbei ist. Sie will wieder mit anderen Menschen zusammensitzen, Menschen, die ihr wichtig sind. Momentan ist die erste Impfung in der Einrichtung durch, es muss noch die zweite folgen. Bis dahin sind die Kontakte auf das Nötigste beschränkt. Danach möchte sie mal wieder ihre Freundin Lilo einladen und ihre andere Freundin Tanee in Bayern besuchen. Auf das Arbeiten in „ihrer Wäscherei“ freut sie sich auch schon und die stationäre Wohneinrichtung ist, wie sie selbst sagt, auch zu einem weiteren Zuhause geworden, neben dem, was sie bei ihrer Familie hat.
Amelie selbst braucht den geschützten Rahmen, den ihr die Arbeit in der Behindertenwerkstatt bietet und ist damit glücklich.
Auch wenn es ihr gut damit geht und sie selbst das System, in dem sie beteiligt ist, nicht erfassen kann, wäre eine Veränderung bzw. Weiterentwicklung von diesem aus vorher genannten Gründen wünschenswert. Dazu bräuchte es allerdings Fürsprecher:innen, die Entscheidungen treffen. Aber agieren diese dann aufgrund von Fakten im besten Sinne?
Text: Svenja Jäger
Illustration: Julia Küttner