Es ist Dienstag, Ende April. Wir schreiben das Jahr 2021. Ein Jahr Pandemie liegt hinter mir und was soll ich sagen? Ich bin auf dem höchsten Level meiner psychischen Instabilität angekommen. Mag man den sozialen Medien & Dr. Google Glauben schenken ist es eine Mischung aus ADHS, Angststörung und Depression. Doch wer weiß das schon so genau in Zeiten, in denen man sich so sehr mit sich befasst, dass es einem Retreat gleicht.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich eigentlich schon seit Stunden schlafen sollte – aber ich bekomme kein Auge zu. Ein Jahr globaler Stillstand und ich hab eine To-Do-Liste, die selbst zu Prä-Corona-Zeiten unmenschlich gewesen wäre. Dazu übt sich die Welt in Selbstliebe und Selbstoptimierung. Ein Spiel mit dem Feuer, wenn man mich fragen würde. Sich so akzeptieren wie man ist und gleichzeitig alles dafür tun, möglichst effizient aus der Pandemie zu kommen? Schwierig.
Und so liege ich hier mitten in der Nacht und kann mal wieder nicht einschlafen. Eine tiefe Angst durchfährt mich und tritt mir mit jedem Atemzug erneut in die Magengrube. Mein Solar Plexus wird zur Dartscheibe meiner undefinierbaren Panik. Dinge, die ich längst verdrängt geglaubt hatte, schießen mir wie Lichtblitze durch den Kopf. Es ist Silvester im limbischen System. Die Amygdala, die finale Destination unzähliger sich selbst zündender Feuerwerksbatterien. Ich kann mich einfach nicht beruhigen.
Seit Stunden versuche ich mich abzulenken, zu meditieren, Podcasts zu hören oder zu arbeiten. Alles vergebens.
Apropos Podcasts: Sag mir, dass du psychische Probleme hast ohne mir zu sagen, dass du psychische Probleme hast. Kein Problem. Dafür reicht ein Blick auf meine Spotify-Jahresstatistik. Rund 97.000 Minuten Podcasts hab ich 2020 gehört. Siebenundneunzig tausend. Das sind ca. 1617 Stunden. Herr Spotify wäre stolz auf mich. Da soll noch einmal jemand sagen, die fünf Euro Monatsgebühr lohnen sich nicht. Ich habe umgerechnet über zwei Monate nonstop damit verbracht mich von mir selbst abzulenken und anderen Menschen dabei zugehört, wie sie sich unterhalten. Alles nur, um mich selbst nicht damit auseinandersetzen zu müssen, wie ich mich fühle, was mich triggert und warum nicht alles wieder so sein kann, wie es einmal war.
Was hier gerade passiert ist für alle psychisch Gesunden Mimimi auf ganz hohem Niveau. Mir geht es die meiste Zeit okay und ich komme gut mit der Pandemie zurecht, habe ich mir mit meinen Freunden doch den perfekten Freundeskreis zusammengestellt, den man sich zu pandemischen Großereignissen nur wünschen könnte: Eine Person depressiver als die andere. Bruder tot, unverarbeitete Kindheitstraumata und konstante Überforderung bilden zusammen das Dreamteam der Verdrängung. Jeder kümmert sich um den mental miserablen Zustand der anderen, nur keiner sich um den eigenen. Willkommen Helfer-Syndrom. Willkommen Teufelskreis.
Und so blöd es auch klingen mag, mir fehlt der Eskapismus. Mir fehlen stumpfe Abende, an denen ich nicht alleine zu Hause in meiner Einzimmerwohnung prokrastiniere und dank Social Media den Glauben daran verliere, dass es anderen Menschen ähnlich gehen könnte wie mir.
Mir fehlt es mich mit fremden Menschen zu unterhalten, auch wenn mir fremde Menschen momentan alleine in ihrer Anwesenheit zu viel sind. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen möchte ich das alles so wird, wie es einmal war und zum anderen wünsche ich mir, dass sich niemals etwas am aktuellen Status Quo ändert. Die Vorstellung sich in sechs bis zwölf Monaten mit wahlweise zehn bis fünfzehn Menschen ein Büro zu teilen, spült direkt den nächsten Mental Breakdown an.
Ich fühle mich wie die Personifikation von Gegensätzen: Exzess und Stillstand, high und nüchtern, die Alte sein und mich neu erfinden.
Ich habe die Hoffnung, dass sich alles von alleine wieder einrenkt, aber wenn ich mir die Frequenz meiner schlaflosen Nächte und meiner Angstattacken so ansehe, macht mir das eher Bauchschmerzen.
Wie das mit dem Leid eben so ist, findet ungewollt ein internes Rennen um den größten Verlierer statt. Und bevor man sich auf uns vermeintlich Gesunde stürzt, möchte ich diesen Wettbewerb vorzeitig verlassen. Momentan gibt es, so blöd es klingen mag, einfach nicht viel Hoffnung. Therapeuten sind überlastet, Ärzte sowieso und von Krankenhäusern müssen wir gar nicht erst anfangen. Solange ich meinen psychisch desolaten Zustand für etwas nutzen kann, bin ich absolut dazu bereit im Sinne des Allgemeinwohls mich meiner selbst weiterhin zu ergeben und an meiner Spotify-Statistik zu feilen.
Text & Bild: Janna Meyer
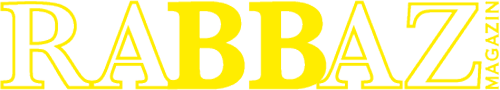
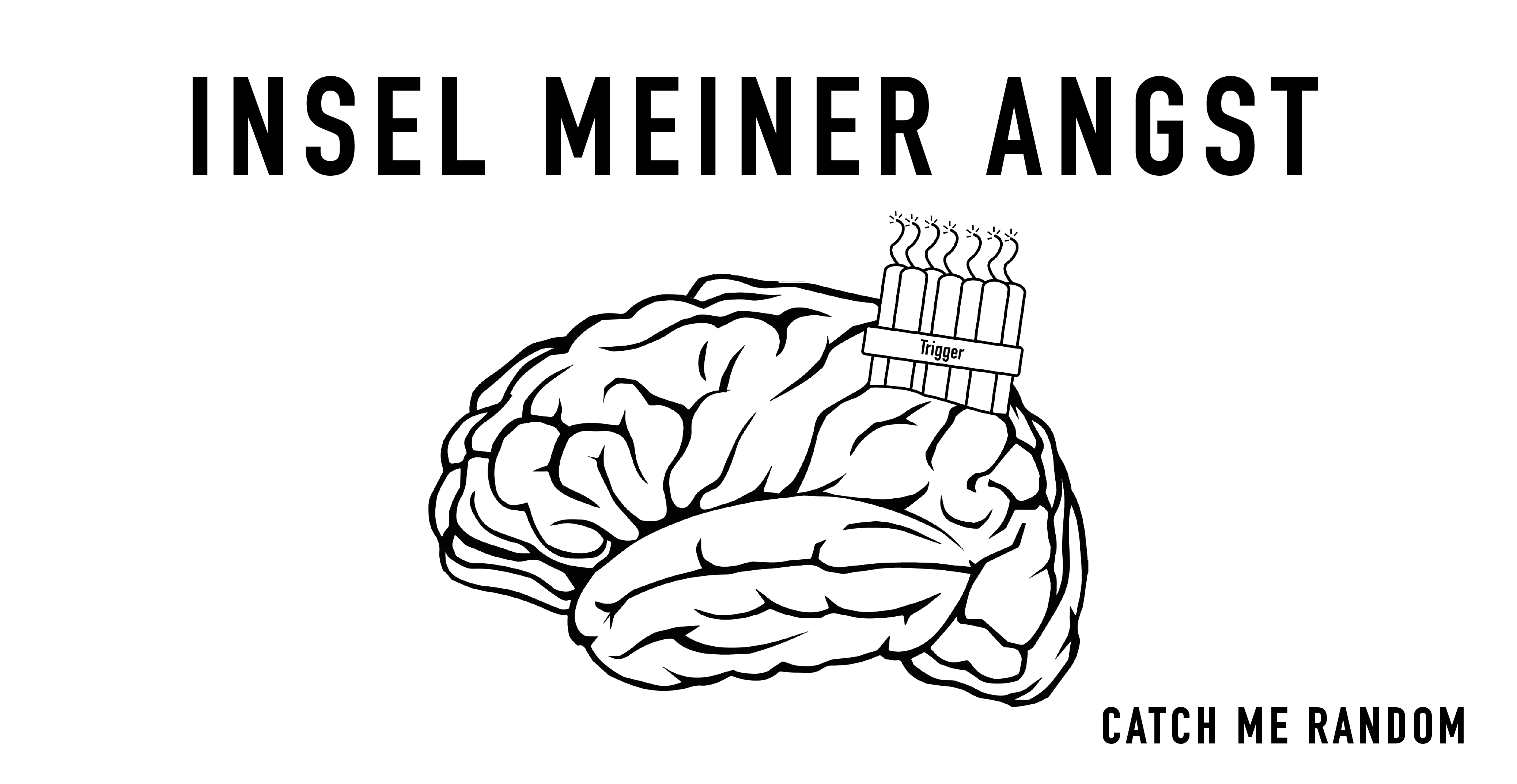




1 Comment
Woah! Ich war zu der Zeit noch nicht alt genug (14/15), um so weit zu denken, doch aus heutiger Sicht ist es echt einleuchtend und ich kann da wirklich mitfühlen, abgesehen von den ganzen biologischen Termini. PhilFak halt, nech… Ja genau, ich habe gerade selber ähnliche Sachen und ich suche mehr oder weniger aktiv nach einem Therapeuten. Langfristig wird’s schon werden. War aber eine Erleichterung, zu wissen, dass es auch andere Menschen gibt, die ihre Traumata literarisch verarbeiten wollen. Das mit deinem Bruder tut mir wirklich sehr leid.
Es wäre echt interessant zu wissen, an welcher Stelle du jetzt bist. Hast du doch noch einen Therapeuten gefunden? Wie geht’s dir? Und wie steht es um die angesprochenen Gewohnheiten und Escapism-Verhaltensweisen?
Genau. Musst aber nicht antworten, obviously.