In diesem kritischen Essay vermischen sich abstrahierte Eindrücke des Theaterstücks „Die Zwölf Geschworenen“ mit dem Versuch einer Einordnung der anklingenden Themen Demokratie, Dialog und menschliche Erfahrung.
Ob der Leitspruch ‘je mehr, desto besser’ in der heutigen Medienlandschaft noch gilt, ist fraglich. Denn mehr bedeutet zwar mehr für alle Interessengruppen, aber auch gleichzeitig mehr zu treffende Entscheidungen für die Einzelperson. Hinzu kommt ein erhöhter Aufwand, diese halbwegs interessanten Medieninhalte zu konsumieren, bis etwas gefunden wird, das dem persönlichen Geschmack entspricht. Soziale Faktoren, wie die Angst, etwas zu verpassen („Fear of missing out“), verstärken den Druck, die Medienflut wie am Fließband zu konsumieren. Als Gegenpol dieser Entscheidungslähmung kennen wir alle persönliche Inseln wie diesen einen Wohlfühl-Herbstfilm, ein Buch, das uns bei jeder erneuten Lektüre mitreißt, nostalgische Playlists vergangener Jahre oder eine unterbewertete Serie, die uns in ein Rabbit Hole schickt, sodass uns die Medienflut rundherum egal sein kann. Da tut es gut, sich ab und zu auf jene Werke zu fokussieren, zu denen wir persönliche Verbindungen pflegen.
Zweimal das gleiche ist nicht zweimal dasselbe
Getreu diesem Motto besuchte ich im April 2023 das Theaterstück „Die Zwölf Geschworenen“ am Theater Chemnitz ein zweites Mal, nachdem ich die Inszenierung von Carsten Knödler bereits 2019 gesehen hatte. Den zugehörigen Filmklassiker „Twelve Angry Men“ (1957, Regie: Sidney Lumet) hatte ich bis dato dreimal gesehen und auch die literarische Vorlage, Reginald Roses Drehbuch, gelesen. An der Inszenierung hatte sich, wie von mir erwartet, rein gar nichts verändert. Mit Ausnahme von zwei neu besetzten Rollen waren mir die anderen Schauspielenden allesamt bereits bekannt, ebenso wie der Ablauf der Argumentation und die Tätigkeiten der zwölf Personen auf der Bühne. Auch die hitzigen Diskussionen und Wutausbrüche hatten sich selbstverständlich nicht geändert. Daher wanderte meine Aufmerksamkeit irgendwann von allein zu den Geschworenen, um deren Schauspielleistungen zu bewundern.
Hier wurden mir als seltenem Theaterbesucher die Vorzüge des Mediums im Vergleich zum Film womöglich zum ersten Mal deutlich bewusst — die Schauspielenden spielen ihre Rollen ohne Unterbrechung in Echtzeit, während die Zuschauenden ihrer begrenzten Aufmerksamkeit mit engem Fokus ausgesetzt sind. Jedes kleinste schauspielerische Detail, ob choreographiert oder improvisiert, ist höchstens für eine Sekunde zu sehen, bevor sich die Erzählung weiter als Verkettung von Gegenwartsmomenten im kontinuierlichen Strom unwiederbringlicher Zeit entfaltet. Anstatt zu verfolgen, was passierte, konzentrierte ich mich vielmehr darauf, wie es passierte. Der Vorzug, den reinen Inhalt bereits gut zu kennen, erlaubte mir schweifende Blicke auf alle zwölf Schauspielenden über das gesamte Stück hinweg. Mimik und Gestik der Geschworenen verdichteten die beobachtbaren Details zusätzlich. Hinzu kommt, dass sich die daraus resultierende Dichte an Schauspielenden, Interaktionen und Details lediglich innerhalb eines Schauplatzes entfalten kann, denn „Die Zwölf Geschworenen“ ist ein Kammerspiel, das ausschließ-lich im Geschworenenzimmer spielt. Erst wenn ein einstimmiges Urteil vorliegt, darf das Zimmer verlassen werden.
Die Ein-Dutzend-Waage auf der Bühne
Zu Beginn widersetzt sich nur Geschworener Nr. 8 den anderen elf Geschworenen, da er nicht sofort mit der Verurteilung des Angeklagten zum Tode einverstanden ist. Er wisse noch nicht genau, was den Argumenten der Staatsanwaltschaft entgegenzuhalten sei, und plädiere daher zumindest für eine grundsätzliche Erörterung des Falles, bevor ein Schuld- und damit Todesurteil gefällt werde. Solange sich auch nur ein einzelner Geschworener weiterhin gegen die Mehrheitsmeinung stellt, sind alle Anwesenden zur Diskussion der Lage gezwungen. Der rote Faden der Handlung beruht auf diesem Stimmenkampf, der einer Tafelwaage gleicht, die von schuldig bis nicht schuldig kippt, je mehr Geschworene ihre Meinung ändern. Obwohl sich der Geschworene Nr. 1 als Obmann anfangs um klare Ordnung bemüht, verwandelt sich diese schnell in unstrukturierte, geradezu realistische Alltags-konversation. Die Geschworenen mäandern durch eine Vielzahl von Themen, die von ‘völlig abseits der Gerichtssache’ bis zu ‘Suche nach gemeinsamen Erkenntnissen’ reichen.
Zunehmend entbrennen emotionale Grundsatzdebatten und kaum ein Geschworener ist vor persönlichen Angriffen gefeit, liefert doch jede ihrer Äußerungen neuen Zündstoff für kleinere Streitigkeiten. Das oberste Ziel eines einstimmigen Urteils geht dabei unter — wie soll bei diesen festgefahrenen Positionen der Geschworenen überhaupt eine Einigung möglich sein? Trotz ihrer individuellen Unzulänglichkeiten sind mehr oder weniger alle Geschworenen dazu bereit, ihre Standpunkte darzulegen, den anderen zuzuhören und die Gegenseite durch Diskussionen vom Gegenteil zu überzeugen — die Mehrheit der Geschworenen verpflichtet sich dem Dialog zur methodischen Wahrheitsfindung.
Wahrheit ist Demokratie ist Menschlichkeit
Die von den Geschworenen angestrebte Wahrheit bleibt jedoch unerreichbar. Die Straftat ist begangen, es bleiben die Zeugenaussagen (schuldig!) und die Zweifel daran (nicht schuldig!). Je nach Interpretation ist ausreichend Spielraum für beide Positionen gegeben. Eine klassische Auflösung über die wahrhaftige Schuld des Angeklagten erfahren daher weder Geschworene noch Zuschauende. Denn der thematische Kern des Stücks liegt in jenen moralisch grauen Situationen verborgen, deren objektive Wahrheit verschleiert ist und die deshalb einen gesell-schaftlichen Konsens verlangen. So sehr sich die Geschworenen auch um Unvoreingenommenheit und richterliche Objektivität bemühen mögen, spielen tief verwurzelte Eigenschaften und Erfahrungen dennoch eine Rolle.
Der Prozess der Konsensfindung verläuft ebenso chaotisch wie realistisch, und allmählich nähern sich die anfänglich zwölf unterschiedlichen Meinungen an — die Mehrheit der Geschworenen findet schließlich im Dialog eine gemeinsame Basis. Diejenigen Geschworenen, deren Argumentation von Vorurteilen geprägt ist, sind mit logischen Argumenten kaum zu überzeugen, werden aber von der Mehrheit mit dem Schild des Konsenses in Schach gehalten. In Form eines demokratischen Mikrokosmos treffen die Geschworenen als Querschnitt der Gesellschaft aufeinander und müssen sich mit Gruppendynamiken sowie divergierenden Meinungen auseinandersetzen. Hierin offenbart sich die Universalität des Stücks, denn wir alle kennen die Diskussionen, die auf grundsätzlichen Ebenen mit gegensätzlichen Standpunkten geführt werden; durch Dialog navigieren wir durch Persönlichkeitseigenschaften und verzerrende Erfahrungen zum angestrebten Verständnis. Somit erinnert „Die Zwölf Geschworenen“ an das Leben innerhalb einer vielfältigen Gesellschaft, deren unterschiedlich positionierte Individuen miteinander auskommen müssen. Das realistisch-authentische Schauspiel verstärkt zudem die Botschaft der menschlichen Erfahrung, die bereits im Stück anklingt. Folglich kann dieses Theaterstück auch als Plädoyer für eine humanistische Diskussionskultur verstanden werden, die stets die Realitätswahrnehmung Anderer respektiert und gegebenenfalls demokratisch korrigiert. Außerdem wird aufgezeigt, dass wir oft irrende Individuen sind, alle mit sehr unterschiedlichen Gemütern, Persönlichkeiten und Erfahrungen, die auf dem Weg zur Wahrheits- und Konsensfindung verständnisvoll miteinander kommunizieren sollten.
Auf Rückblick, Rückkehr, Rückbesinnung
Ich wiederhole mich: Ich kann von diesem Stück nicht genug bekommen und werde mir auch weitere Interpretationen, ob Fernsehfilm oder Theateraufzeichnung, zu Gemüte führen. Auch wenn sich der Inhalt nie ändert, so ist doch die Darstellung eine andere, nicht zuletzt wegen der Schauspielenden, die dem Werk auf ihre ganz eigenen Weisen Leben und Menschsein einhauchen, dass ich jedes Mal aufs Neue verzaubert bin. Vielleicht habe ich bei euch das Interesse an „Die Zwölf Geschworenen“ oder am Theater selbst geweckt. Vielleicht kehrt ihr aber auch einmal zu einem Lieblingswerk zurück und erkundet es mit neuer Wertschätzung aus einem anderen Blickwinkel oder verschiedenen Medienformaten. Klammert euch inmitten der Medienflut an jene Werke, die euch ansprechen, inspirieren und etwas in euch wecken.
Text: Konstantin Gora
Picture: Annabella B.
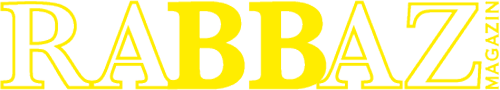





No comment yet, add your voice below!