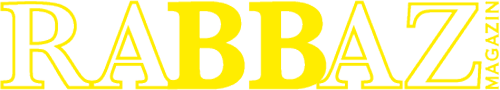Paris, Notre Dame: stundenlang reden die Leute darüber, tagelang besteht mein Feed in den Sozialen Netzwerken aus Spendenaufrufen, Beileidsbekundungen und traurigen Emoticons. Bei Hanau, dem bereits dritten rechtsradikalen Anschlag innerhalb weniger Monate, verstummen die meisten. Ich jedenfalls sehe niemanden. Sind es die Shisha-Bars? Sind es die Fremden, die ihr erkennt? Oder glaubt ihr an das Privileg des unpolitischen Schweigens? Hanau sind wir alle!
Die Geschehnisse in Hanau erschüttern die Republik und erreichen trotz allem wenige. Hanau ist überall. Rechtsradikale Gewalt ist tagtäglich und in unserer demokratischen Gesellschaft allgegenwärtig – leider nicht erst seit den vergangenen Tagen. Wir sind es den Opfern des Anschlags schuldig, die Grundstrukturen in Politik, Medienlandschaft und in unseren Köpfen aufzubrechen.
Es ist beleidigend und beinahe ironisch, wenn dem türkischen Präsidenten Erdogan Mitleid bekundet wird, wenn man bedenkt, und das sollten wir, das die Menschen, die bei diesem Anschlag ums Leben gekommen sind, unteranderem Minderheiten sind, die auch vor Erdogans Terror flüchten. Kurden sind in der Türkei “Berg-Türken“, in Deutschland “Ausländische Türken“, wenn also Nationalitätt in den Kontext eingeführt wird, wieso dann nicht mit entsprechendem Respekt. Auch die Gäste des Maybrit Illner Spezials zu Hanau schockieren - Kübra Gümüsay die zu antikurdischem, antialevitischem und antiezidischem Terror schweigt, kann nicht das Gesicht der Minderheit sein!
Die Liste ist lang...
Wenn sie von Fremdenfeindlichkeit reden und nicht rassistisch sagen, übernehmen sie das Narrativ der Rechtsextremen, wo Menschen phänotypisch nicht zu Deutschland gehören, wonach Menschen als Fremde gelabelt werden. Fremde gibt es nicht, wir machen sie zu Fremden! Es muss nachdenklich und wütend machen, dass die Betroffenen immer wieder warnen müssen! Solange wir schweigen, umformulieren, besänftigen, um “kein Chaos“ zu stiften, solange sind wir verantwortlich für jedes weitere Opfer, schreiben weiter die viel zu lange Liste von Mitschuld, sehen Motiv und Problem nicht: Rassismus.
Rassismus ist nicht mit Lippenbekenntnissen abzuhaken, auch wenn Solidarität für die Opfer unabdingbar ist: Sie müssen wissen, dass sie nicht allein sind. Aber noch wichtiger ist es, die dahinterstehenden Grundstrukturen aufzudecken - jetzt! Jeder und jede Einzelne steht in Verantwortung solidarisch zu sein, was damit beginnt, sich mit den Menschen, mit ihren Fragen, ihren Sorgen und Meinungen auseinanderzusetzen. Wir müssen an allen Ecken der Gesellschaft mit Nachdruck daran arbeiten, im Namen aller Opfer, aller Hinterbliebenen und aller Betroffenen.
Und Chemnitz, wo bist du? Vor allem dir steht Schweigen und Wegschauen nicht zu. Hanau ist keine Randnotiz, seine Shisha-Bars und Imbisse existieren mitten unter uns. Wenn es uns schwerfällt zu verstehen, dass die Angst unserer Mitmenschen real ist, wenn es schwerfällt, zu verstehen und nicht weniger betroffen zu sein, dann lasst uns nicht vergessen, dass uns kein Terrorist nach dem Pass fragt.
Text: Redaktion
Illustration: Julia Kütter