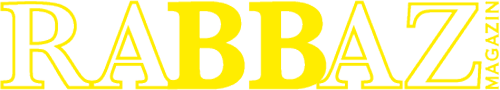*****Triggerwarnung: Psychische Erkrankungen, Depression*****
Hier ist er. Der Winter. Lange Nächte, kurze Tage. Die Farbe des Himmels wechselt die Grautöne, die Lage des Wetters wechselt zwischen bewölkt, windig, Schneeregen und Schnee. Ich starre durch das Fenster nach draußen und mache eine gedankliche Notiz, meine Tageslichtlampe zu reaktivieren.
“Mit Beginn des Novembers fühle ich mich auf seltsame Weise zu dem dunklen Teil meiner Garderobe hingezogen. Ich habe viel zu tun, aber bleibe lieber liegen. Statt nach dem ersten Klingeln des Weckers aufzustehen, drücke ich die Schlummertaste 100 mal und prokrastiniere so lang vor mich hin bis ich mir einreden kann, dass es eh nicht mehr viel bringen würde noch mit Unisachen anzufangen. Meine Konzentrationsfähigkeit sinkt auf ein Minimum, mein Kopf fühlt sich an als wäre er statt mit grauen und weißen Zellen mit Watte ausgekleidet.
Der Drang nach Veränderung wächst. Haare färben? Piercing? Tattoo? Küche renovieren? Neue Gardinen im Schlafzimmer? Ach, warum nicht einfach alles zusammen? Mit der Umgestaltung äußerer Umstände bzw. meiner äußeren Entscheidung verdränge ich meine eigentliche Unzufriedenheit, die sich aus den Tiefen meiner inneren Abgründe langsam nach außen frisst. Sie nagt, sie knabbert, sie kaut auf meiner Lebkuchenhausfassade herum. Die Löcher kann ich nur noch schlecht mit ein bisschen Puderzuckerguss und Gummibärchen flicken. Aber wer mein Haus kennt, weiß, dass die Fassade bröckelt. Fragen wie: “Wie geht`s dir?” oder “Alles in Ordnung?” kann ich nicht mehr weglächeln oder übergehen. Komplimente wie “Du siehst viel lebendiger aus!” nicke ich ab und denke mir meinen Teil. Ich fühle mich nicht lebendig. Das hier fühlt sich auch nicht wie mein Leben an, sondern nur so, als würde ich zusehen, daneben stehen und ein paar unqualifizierte Bemerkungen aus dem Off machen. Fühlen ist auch das falsche Wort. Ich fühle auch nichts mehr. Jedenfalls nicht so wie vorher. Vielleicht habe ich auch den Zugang zu meinen Gefühlen verloren. Ich weiß es nicht. Es ist alles so wie das Wetter, kurze Tage, lange Nächte, wechselnde Grautöne.”
Frau Krause schaut erst meine Betreuerin, dann mich an. Ihre Augen sind mit Tränen gefüllt, aber auffallend leer. Sie liegen tief in den Höhlen, ihre Wangen sind eingefallen. Sie sitzt nach vorn gebeugt, eher geknickt auf ihrem Stuhl, die Hände liegen in ihrem Schoß, sie nestelt an ihren Fingern herum. Der Monolog war die Antwort auf die Frage warum sie hier sei. Mit “hier” ist die ambulante psychotherapeutische Praxis gemeint, in der ich aktuell mein Praktikum absolviere. Frau Krause ist in einem ähnlichen Alter, irgendwo Anfang 20, irgendwo zwischen Studium, Nebenjob und WG- Leben. Wenn Frau Krause und ich uns nicht hier kennengelernt hätten, dann sicher auf einer Feier in einem der Studiclubs am Campus. Frau Krause und ich hätten Freundinnen sein können.
Aber hier sitzen wir. Drei Frauen in einem Raum, ein Zettel, ein Stift, eine Box mit Taschentüchern, eine Monstera in der Ecke. Man sieht Frau Krause an, dass es ihr nicht gut geht, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Die im Raum stehende Scham ist erdrückend. Frau Krause schämt sich dafür, hier zu sitzen. Bei Menschen, die ihr helfen können. Sie schämt sich, dass sie professionelle Hilfe bei ihren Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen, in ihrem Alltag braucht.
So viele Menschen schämen sich dafür, obwohl es ganz normal ist. So viele Menschen fühlen sich anders, nicht “normal” und wie ein Fehler im System. Scham und psychische Erkrankungen gehen Hand in Hand. Physische Erkrankungen hingegen sind komplett akzeptiert. Es ist vollkommen normal, sich bei Erkältungen, verstauchten Knöcheln oder Rückenschmerzen professionelle Hilfe zu suchen. Niemand hinterfragt einen Gips, alle wollen darauf unterschreiben. Bei psychischen Erkrankungen sieht das ganz anders aus: ungewollte, unempathische Fragen oder Bemerkungen wie “Ach, aber dir gehts doch gut. Sei nicht so undankbar”, oder “steh halt einfach eher auf und geh zum Sport” sind Gang und Gebe. Vermeintliche Ursachenfaktoren: falsche Ernährung, fehlende Vitamine, zu wenig Sport und mein absoluter Favorit bei Kindern und Jugendlichen: das Handy. Während all diese Dinge zur Entstehung einer psychischen Erkrankung beitragen können, so gibt es aber nicht DEN EINZIGEN FAKTOR, auf den alles zurückzuführen ist. Es ist eher wie beim Schach: am Anfang geht der Bauer verloren, irgendwann die Pferde, dann der Turm, die Dame und zack: Schachmatt. Aber wie auch bei einem Schachspiel ist der Weg dahin nicht immer gleich und verallgemeinerbar, deshalb sind auch die Lösungen nicht trivial und einfach.
“Good Vibes Only” ist das Motto dieser Zeit. Es blinkt mir täglich entgegen und ist so toxisch, dass ich mich übergeben möchte. Es trägt dazu bei, dass Menschen sich noch schlechter fühlen. Sie fühlen sich schlecht, weil sie sich schlecht fühlen. Meta-schlecht quasi. Das Empfinden einer ständigen Glückseligkeit ist jedoch utopisch. In einer Gesellschaft, die das ständige Glücklichsein mit permanenten Urlaubsgefühlen als die Normalität anpreist und im Gegenzug den Menschen durch Leistung definiert, ist es wirklich nicht verwunderlich, dass Menschen nicht über ihre Gefühle sprechen wollen, sie verdrängen, sich vor ihnen verschließen und sich selbst belügen. Die Frage nach dem Befinden wird automatisch mit “gut” beantwortet und im schlimmsten aller Fälle mit “passt schon”. Es wird selten nachgefragt und wenn, dann bestehen Antworten aus Ausreden wie “Ach, der ganz normale Wahnsinn” oder “Stress auf der Arbeit”. Die Blicke oder allein die Angst vor den Blicken und Reaktionen der Mitmenschen reichen aus, um die Abwesenheit des Wohlbefindens mit sich selbst auszumachen. Niemand möchte als “verrückt” abgestempelt werden. Heute benutzt man Worte wie “Klapse” oder “Irrenhaus” zwar nicht mehr so oft, jedenfalls nicht in meiner Generation, aber die Vorurteile über psychische Erkrankungen sind tief verwurzelt. Die Aufklärung und Edukation erfolgt nur spärlich und qualitativ auf einem Niveau, das der Moderne nicht angemessen ist. Auch die mediale Auseinandersetzung mit dem Themenbereich ist mehr als dürftig. Reportagen sind einseitig. In den Nachrichten sind nur die schlimmsten aller Ausprägungen psychischer Erkrankungen zu erleben. Psychische Erkrankungen werden über einen Kamm geschert, verallgemeinert und nicht differenziert genug betrachtet. Menschen werden in Schubladen gesteckt, in die sie nicht passen. Kein Wunder also, dass die Scham so groß ist.
Allerdings erstreckt sich unser Gefühlsspektrum nicht ausschließlich in das Positive, sondern eben auch in das Negative. Wenn man sich die Basisemotionen nach Ekman anschaut, dann überwiegen sie sogar. Von den sechs Grundpfeilern unserer Gefühlswelt (jedenfalls nach Ekman) befinden sich zwei auf dem positiven Spektrum: Freude und Überraschung, wobei die Überraschung auch nicht immer gut sein muss. Die anderen – Angst, Trauer, Wut und Ekel, sind in unserer heutigen Gesellschaft negativ konnotiert. Dabei kommt den Gefühlen eine große Bedeutung zu: sie sind Indikatoren für das Überleben. Während wir heute vielleicht nicht mehr vor Säbelzahntigern wegrennen müssen, so jagen uns andere Dinge schreckliche Angst ein. Die Zukunft ist es zum Beispiel bei mir. Mein Studium neigt sich dem Ende entgegen und ich weiß absolut nicht, in welche Richtung ich will – weder geografisch noch fachlich. Die Welt steht mir mehr oder weniger offen, es gibt zu viel Auswahl und gleichzeitig sehe ich am Ende des Studiumtunnels die Arbeitswelt ihre Zähne blecken. Ich bin sicher, Frau Krause geht es ähnlich. Wie gern würde ich ihr sagen, dass ich sie verstehe. Ich kann ihre Gefühle und Gedanken nachvollziehen. Gerade jetzt im Winter. Lange Nächte, kurze Tage. Die Farbe des Himmels wechselt die Grautöne, die Lage des Wetters und meiner Stimmung wechselt zwischen bewölkt, windig, Schneeregen und Schnee.
“Frau Krause, Sie sind nicht allein auf der Welt mit ihren Problemen”, als könnte meine Betreuerin meine Gedanken lesen, “es geht vielen Menschen ähnlich. Ganz viele Menschen haben mit ähnlichen Symptomen zu kämpfen. Das Gute ist aber, dass wir Ihnen helfen können. Sie sind die ersten Schritte gegangen. Gemeinsam schaffen wir das”.
Sie sieht uns in einer Mischung aus Unglauben, Trauer und Verlorenheit an. Gedankenschwere, Gedankenkreisen, Gedankenspiralen schwingen in ihren Blicken mit. Sie bleibt still, schnieft kurz und nickt dann kaum merklich während Schneeflocken beginnen zu fallen. “Ich hasse Schnee und Kälte”, murmelt sie vor sich hin und die drei Frauen im Raum wissen, dass damit nicht nur das Wetter gemeint ist.
Text: Ilka Reichelt
Bild: Francesco Ungaro
Anmerkungen:
Die Charaktere und Dialoge sind fiktiv. Sie sind lediglich an eigene Erfahrungen angelehnt.
Sollte es Dir momentan nicht gut gehen und du Hilfe benötigen, so kannst Du dich zunächst an wichtige Notfalltelefone wenden oder bei der Telefonseelsorge melden.